Unfall im Ausland: Was tun? | Zentralruf der Autoversicherer
Wie reagieren Sie nach einem Unfall im Ausland? Wann brauchen Sie die Grüne Karte? Lesen Sie wichtige Tipps und Handlungsschritte im Blog.

Unfall im Ausland: So verhalten Sie sich richtig im Ernstfall
Wer in den wohlverdienten Urlaub fährt, rechnet nicht mit einem Unfall. Wenn es kracht, ist nicht nur die Überraschung groß, sondern häufig auch die Unsicherheit – besonders wenn es sich um einen Verkehrsunfall im Ausland handelt. Wir erklären, wie Sie sich nach einem Autounfall mit einem ausländischen Fahrzeug richtig verhalten, wie Sie den Unfall dokumentieren und welche Unterlagen Sie jederzeit parat haben sollten. Erfahren Sie im Blog außerdem, welche Anlaufstellen Ihnen weiterhelfen und warum ein Anwalt für Verkehrsrecht immer eine empfehlenswerte Wahl ist.
Übersicht:
- Welche Unterlagen brauche ich bei einem Autounfall im Ausland?
- Wie verhalte ich mich nach einem Unfall im Ausland?
- Wie fülle ich den Unfallbericht aus?
- Sollte ich nach einem Unfall die Polizei verständigen?
- Was ist zu beachten, wenn ich mit einem ausländischen Mietwagen einen Unfall haben?
- Wie verläuft die Schadensregulierung nach einem Unfall im Ausland?
- Warum ist es sinnvoll, eine Ausland-Schadenschutz-Versicherung abzuschließen?
- Fazit: So handeln Sie nach einem Autounfall im Ausland
1. Welche Unterlagen brauche ich bei einem Autounfall im Ausland?
Verreisen Sie ins EU-Ausland oder Ausland, sollten Sie einige Unterlagen dabeihaben. Denn egal, wie vorausschauend Sie fahren, besteht immer ein Unfallrisiko. Um die Unfallstelle zu sichern und im Notfall Erste Hilfe leisten zu können, dürfen Warndreieck, Warnweste und Verbandskasten in Ihrem Auto nicht fehlen. Zusätzlich ist es sehr empfehlenswert, sich vor Ihrem Urlaub mit den Bestimmungen und Verkehrsregeln in Ihrem Urlaubsland vertraut zu machen. Gleiches gilt für die Länder, die Sie auf dem Weg zu Ihrem Ziel durchqueren.
In Großbritannien, Irland und Australien gilt beispielsweise Linksverkehr. Finden Sie in den USA ein 4-Way-Schild, fährt derjenigen zuerst, der die Kreuzung als erster erreicht hat. Zudem variieren die Regelungen von Land zu Land, wenn es um Alkohol am Steuer und Telefonate während der Fahrt geht. Indem Sie sich vor Reisebeginn ausführlich informieren, reduzieren Sie einerseits das Risiko für einen Verkehrsunfall und vermeiden andererseits Ordnungswidrigkeiten und Bußgelder. Neben den genannten Tipps sind die folgenden Unterlagen unverzichtbar.

Europäischer oder Internationaler Unfallbericht
Möchten Sie Ihren Urlaub außerhalb von Deutschland verbringen, besteht immer das Risiko für einen Unfall mit einem ausländischen Auto – auch wenn Sie noch so vorausschauend fahren. Wir empfehlen Ihnen deshalb, bei jeder Reise ins EU-Ausland den Europäischen Unfallbericht mitzuführen. Verlassen Sie die EU, sollte der Internationale Unfallbericht nicht in Ihren Unterlagen fehlen. Beide Papiere dienen einer lückenlosen und einheitlichen Unfalldokumentation, die sowohl Sie als auch Ihr Unfallgegner ausfüllen. Dies erleichtert die spätere Schadensabwicklung und sorgt für eine bestmögliche Beweissicherung.
Idealerweise führen Sie den Europäischen oder Internationalen Unfallbericht in deutscher und englischer Ausführung mit sich. Von Vorteil ist es, wenn Sie auch eine Ausführung in der Sprache Ihres Urlaubslandes parat haben. Gleiches gilt für die Länder, die Sie auf dem Weg an Ihr Ziel durchqueren.

Grüne Karte
Zusätzlich zum Unfallbericht ist die sogenannte Grüne Karte für einige Länder verpflichtend. Sie dient im Ausland als ein Nachweis Ihrer Haftpflichtversicherung und wird kostenfrei von Ihrer eigenen Kfz-Versicherung an Sie ausgegeben. Die Karte fasst alle relevanten Angaben zusammen, die Ihr Auto und Ihre Versicherung betreffen.
In den Mitgliedstaaten der EU sowie Liechtenstein, der Schweiz, Norwegen, Island, Montenegro und Serbien ist es nicht mehr verpflichtend, eine Grüne Karte mit sich zu führen. Bei einem Autounfall kann sie allerdings trotzdem hilfreich sein, da Sie Ihre Daten unkompliziert mit Ihrem Unfallgegner austauschen können. In Ländern wie der Türkei, Nordmazedonien, Albanien und Bosnien-Herzegowina ist das Mitführen des Dokuments hingegen verpflichtend. Wenn Sie unsicher sind, ob Sie die Karte in Ihrem Reiseland benötigen, fragen Sie am besten vor Ihrem Urlaub bei Ihrer Kfz-Versicherung nach.
Infobox: Die Grüne Karte ist seit 2020 weiß
Obwohl sie immer noch als Grüne Karte bekannt ist, zeigt sich die Internationale Versicherungskarte seit Oktober 2020 als weißes Papier. Wichtig ist außerdem, dass eine digitale Version im Fall der Fälle nicht ausreicht. In den Ländern, in denen sie verpflichtend ist, müssen Sie stets einen Ausdruck dabeihaben.
Mallorca-Police
Für die Zulassung Ihres Kfz müssen Sie eine Haftpflichtversicherung abschließen. Fahren Sie mit Ihrem Auto ins Ausland, ist zusätzlich eine sogenannte Mallorca-Police empfehlenswert. Prüfen Sie am besten vor Ihrem Urlaub, ob sie Bestandteil Ihrer Kfz-Versicherung ist. Die Police sichert potenzielle Haftpflichtschäden im Ausland mit einer höheren Deckungssumme ab. Das ist wichtig, denn die Beträge liegen bei deutschen Versicherungen häufig deutlich höher als bei ausländischen. Liegt die Mindestdeckungssumme in Deutschland bei rund 2,5 Millionen Euro, zahlen ausländische Kfz-Haftpflichtversicherungen häufig einen maximalen Betrag von 100.000 Euro.
Die Mallorca-Police ist in allen EU-Ländern gültig und schließt die Türkei ein. Verreisen Sie in Länder außerhalb der Europäischen Union, ist eine Traveller Police empfehlenswert. Diese garantiert allerdings nur eine Deckung höherer Haftpflichtschäden und greift nicht bei Kaskoschäden am eigenen Fahrzeug.

2. Wie verhalte ich mich nach einem Unfall im Ausland?
Ein Verkehrsunfall passiert oft plötzlich und überrascht Betroffene. Egal, ob Sie verärgert, geschockt oder vielleicht sogar verletzt sind: Versuchen Sie, im ersten Moment Ruhe zu bewahren und agieren Sie besonnen.
- Sichern Sie die Unfallstelle, indem Sie unmittelbar die Warnblinkanlage einschalten.
- Streifen Sie sich eine Warnweste über und achten Sie darauf, dass auch Ihre Mitfahrer eine Warnweste tragen.
- Stellen Sie schnell das Warndreieck auf.
- Prüfen Sie, ob es verletzte Personen gibt, und verständigen Sie bei Bedarf den Rettungsdienst. In Europa wählen Sie 112, in den USA 911.
- Übernehmen Sie die Erstversorgung der Verletzten oder versuchen Sie, diese zu beruhigen.
Haben Sie diese Schritte befolgt, warten Sie, bis die Polizei und Rettungskräfte eingetroffen sind. Nach deren Eintreffen oder wenn deren Unterstützung nicht notwendig ist, kümmern Sie sich idealerweise um folgende Dinge:
- Lassen Sie Ihre eigenen Verletzungen von einem Arzt dokumentieren.
- Tauschen Sie Ihre Kontaktinformationen mit Ihrem Unfallgegner aus.
- Füllen Sie den Europäischen oder Internationalen Unfallbericht aus. Fertigen Sie Bilder und Videos von der Unfallstelle an. Ein Smartphone reicht in der Regel für die Dokumentation.
- Verständigen Sie Ihre eigene Versicherung und kontaktieren Sie, wenn möglich, auch die gegnerische Versicherung.
- Suchen Sie nach Zeugen und notieren Sie deren Anschrift sowie Kontaktinformationen.
Infobox: Schalten Sie im Idealfall einen auf Verkehrsrecht spezialisierten Anwalt ein
Waren Sie in einen Unfall im Ausland verwickelt, ist es immer empfehlenswert, einen Anwalt für Verkehrsrecht hinzuzuziehen. Ein Experte wie Alexander Einfinger unterstützt Sie bei der Unfallregulierung und setzt Ihre Ansprüche auch gerichtlich für Sie durch. Indem Sie sich auf einen erfahrenen Anwalt verlassen, können Sie sicher sein, dass Ihr Unfall bestmöglich reguliert wird. Besonders wenn es um die Frage nach der Unfallschuld geht, lohnt es sich, einen Anwalt für Verkehrsrecht hinzuzuziehen.

3. Wie fülle ich den Unfallbericht aus?
Für die Schadensregulierung muss zunächst festgestellt werden, wer die Schuld am Verkehrsunfall trägt. Abhängig davon, ob Sie oder Ihr Unfallgegner die volle Schuld oder eine Teilschuld tragen, ist entweder Ihre Versicherung oder die gegnerische Versicherung für die Unfallregulierung zuständig. Indem alle Unfallbeteiligten einen Unfallbericht ausfüllen, lässt sich der Ablauf des Unfalls exakt festhalten.
Wichtig sind folgende Punkte:
- Datum und Uhrzeit des Unfalls
- Unfallort
- Zahl der verletzten Personen
- Daten der beteiligten Fahrzeuge
- Umstände des Unfalls
- Unfallskizze
- Sichtbare Schäden an den Fahrzeugen
- Kontaktdaten der Unfallteilnehmer
- Kontaktdaten der Zeugen
- Unterschriften der Beteiligten
Neben der Unfallskizze ist es empfehlenswert, Bilder und Videos anzufertigen. Nehmen Sie Schäden auf, dokumentieren Sie die Unfallstelle und fotografieren Sie auch Details wie Bremsspuren und Glassplitter.
Infobox: Unterschreiben Sie ausschließlich Berichte, die Sie bis ins Detail verstehen Üblicherweise schließen Sie Ihren Unfallbericht sowohl mit Ihrer eigenen Unterschrift als auch mit der Unterschrift Ihres Unfallgegners ab. Gleiches gilt für dessen Bericht. Wichtig ist hierbei, dass Sie ausschließlich Dokumente unterschreiben, die Sie bis ins Detail verstehen und denen Sie zu 100 Prozent zustimmen. In einigen Ländern wie den Benelux-Staaten und Frankreich kommt dem Unfallbericht eine gewichtige Rolle zu, wenn es um die Schadensregulierung geht.
Halten Sie Anmerkungen und Widersprüche unbedingt unter Punkt 14 fest. Bestehen widersprüchliche Unfallschilderungen oder Sprachschwierigkeiten, füllen beide Beteiligten nur ihren eigenen Bericht aus. Tauschen Sie die Kopien anschließend mit Ihrem Unfallgegner.

4. Sollte ich nach einem Unfall die Polizei verständigen?
Hat es im Ausland gekracht, lohnt es sich in jedem Fall, die Polizei zu rufen. In einigen Ländern wie beispielsweise Frankreich sind Polizisten nicht dazu verpflichtet, geringfügige Schäden zu erfassen. In anderen europäischen Ländern wie Bulgarien, Ungarn und Polen müssen Sie selbst Bagatellschäden von der Polizei aufnehmen lassen, um eine spätere Regulierung des Unfalls zu ermöglichen. In Rumänien sind Unfälle sogar meldepflichtig.
Wichtig ist, dass Sie sich niemals zu einem Schuldeingeständnis bewegen lassen. Kommt es später zu einem gerichtlichen Prozess, wirkt sich ein Schuldeingeständnis – besonders gegenüber der Polizei – sehr nachteilig für Sie aus. Bitten Sie die Polizisten aber in jedem Fall um ein Unfallprotokoll.
5. Was ist zu beachten, wenn ich mit einem ausländischen Mietwagen einen Unfall haben?
Werden Sie mit Ihrem Mietwagen im Ausland in einen Unfall verwickelt, gehen Sie prinzipiell genauso vor, wie wenn Sie mit Ihrem Privatfahrzeug unterwegs sind. Sichern Sie die Unfallstelle, verständigen Sie Rettungskräfte und versorgen Sie gegebenenfalls verletzte Personen. Füllen Sie außerdem Ihren Unfallbericht aus, rufen Sie die Polizei und lassen Sie sich von dieser ein Unfallprotokoll aushändigen.
Bei einem Unfall mit einem Mietwagen sind Sie verpflichtet, auch Ihre Autovermietung zu informieren. Lassen Sie sich bei der Rückgabe des Unfallwagens einen Schadensbericht ausstellen und reichen Sie diesen mit weiteren notwendigen Dokumenten bei Ihrer Autoversicherung ein.
Wie auch bei einem Privatwagen lohnt es sich, im Vorhinein die Deckungssumme der Kfz-Versicherung zu prüfen. Idealerweise beinhaltet diese eine Mallorca-Police, die Sie vor hohen Kosten schützt. Insbesondere bei Personenschäden können entsprechende Ansprüche entstehen, sodass Sie ohne eine ausreichende Deckungssumme Ihrer Versicherung schnell auf einem großen Kostenberg sitzenbleiben können.
6. Wie verläuft die Schadensregulierung nach einem Unfall im Ausland?
Autounfall im EU-Ausland
Fahren Sie ins EU-Ausland und werden in einen Verkehrsunfall verwickelt, stellt sich für die Schadensregulierung zunächst die Frage nach der Schuld. Haben Sie den Unfall selbst verursacht, übernimmt Ihre Kfz-Haftpflichtversicherung die Kosten Ihres Unfallgegners. Idealerweise verfügen Sie über eine Vollkaskoversicherung, denn diese übernimmt auch Schäden am eigenen Auto unabhängig von der Schuldfrage.
Trägt Ihr Unfallgegner die Schuld, werden Sie von dessen Versicherung kontaktiert. In den meisten Fällen empfiehlt es sich jedoch, selbst aktiv zu werden. Alle europäischen Versicherungen verfügen in jedem EU-Land über einen Schadenregulierungsbeauftragten. Werden Sie beispielsweise in den Niederlanden in einen Autounfall verwickelt, verständigen Sie den Beauftragten der Niederlanden:
- Zentralruf der Autoversicherer in Deutschland: 0800 250 2600 (kostenfrei)
- Zentralruf der Autoversicherer im EU-Ausland: +49 40300 330300 (gebührenpflichtig)
In beiden Fällen ist es ratsam, frühzeitig einen Anwalt für Verkehrsrecht einzuschalten. Egal, ob Sie Opfer, Betroffener oder Verursacher eines Unfalls sind: Ein Anwalt wie Alexander Einfinger unterstützt Sie bei der Schadensregulierung und setzt Ihre Ansprüche bei Bedarf auch vor Gericht durch. Den Experten ziehen Sie ganz unkompliziert hinzu, indem Sie einen Unfallfragebogen ausfüllen und sich anschließend über das weitere Vorgehen abstimmen.
Autounfall außerhalb der EU
Kommt es in einem Nicht-EU-Land zu einem Verkehrsunfall, fällt die Schadensregulierung oft komplizierter aus. Am besten kontaktieren Sie einen Anwalt, der Ihnen eine wertvolle Unterstützung bietet. Bei bürokratischen Hürden hilft Ihnen der Bürgerservice des Auswärtigen Amts weiter. Mit einem auf Verkehrsrecht spezialisierten Anwalt stehen Sie jedoch auf der sicheren Seite und können sich auf die bestmögliche Unfallregulierung verlassen.

Verkehrsopferhilfe
Wie lange die Schadensregulierung dauert, variiert von Fall zu Fall. Sie zieht sich vor allem dann in die Länge, wenn Ihr Unfallgegner Fahrerflucht begeht und das gegnerische Unfallauto nicht ermittelt werden kann. Auch wenn der Unfallverursacher nicht bereit ist, für die Schäden aufzukommen, verzögert sich die Regulierung. Nach drei Monaten können Sie sich in bestimmten Fällen an die deutsche Verkehrsopferhilfe (VOH) wenden. Diese ist nicht dazu verpflichtet, Ihnen eine Entschädigung zu zahlen. Im Notfall ist es jedoch einen Versuch wert.
7. Warum ist es sinnvoll, eine Ausland-Schadenschutz-Versicherung abzuschließen?
Wenn es im Ausland kracht, greift in der Regel das Schadensersatzrecht des jeweiligen Landes. Auch wenn Sie sich im EU-Ausland befinden, steht Ihnen die Übernahme von Nutzungsausfall, Wertminderung und Mietwagen- sowie Anwaltskosten womöglich nicht in der üblichen Höhe oder gar nicht zu. Schutz vor hohen Kosten bietet Ihnen eine Ausland-Schadenschutz-Versicherung, die Sie in Verbindung mit Ihrer Kfz-Versicherung abschließen können.
Bei dieser zusätzlichen Versicherung garantiert Ihr Versicherer, dass er Personen- und Sachschäden nach einem Unfall mit einem ausländischen Fahrzeug so reguliert, als hätte sich der Unfall in Deutschland ereignet. Das bedeutet, dass nicht die gegnerische Kfz-Haftpflichtversicherung für Schäden an Ihrem Fahrzeug aufkommt, sondern Ihre eigene Versicherung.
8. Fazit: So handeln Sie nach einem Autounfall im Ausland
Verreisen Sie ins Ausland, sollten Sie für den Fall der Fälle alle wichtigen Unterlagen dabeihaben. Dazu gehören der Europäische oder Internationale Unfallbericht und die Grüne Karte. Außerdem sind Warnweste, Warndreieck und Verbandskasten unverzichtbar. Indem Sie sich im Vorhinein mit den Bestimmungen und Verkehrsregeln in Ihrem Urlaubsland vertraut machen, reduzieren Sie das Risiko für einen Verkehrsunfall sowie Bußgelder. Eine sogenannte Mallorca-Police beziehungsweise eine Traveller-Police erhöht die Deckungssummer Ihrer Kfz-Haftpflichtversicherung und schützt Sie vor hohen Kosten.
Hat es im Ausland gekracht, sichern Sie zuerst die Verkehrsstelle. Schalten Sie die Warnblinkanlage an, streifen Sie Ihre Warnweste über und stellen Sie das Warndreieck auf. Rufen Sie bei Verletzten den Rettungsdienst und leisten Sie gegebenenfalls Erste Hilfe. Lassen Sie eigene Verletzungen von einem Arzt dokumentieren und füllen Sie Ihren Unfallbericht aus. Fertigen Sie Fotos und Videos von der Unfallstelle an und tauschen Sie Ihre Kontaktdaten mit Ihrem Unfallgegner sowie Zeugen aus. Kontaktieren Sie anschließend Ihre Kfz-Versicherung und informieren Sie bei einem Mietwagen Ihre Autovermietung.
Für eine schnelle Schadensregulierung ist es wichtig, dass Sie Ihren Unfallbericht möglichst lückenlos ausfüllen. Er trägt dazu bei, die Frage nach der Unfallschuld zu klären, die der Regulierung vorausgeht. Haben Sie den Unfall verursacht, übernimmt Ihre Haftpflichtversicherung die Kosten Ihres Unfallgegners. Trägt dieser die Schuld, kommt seine Versicherung für Ihre Autoschäden auf. Über den Zentralruf der Autoversicherer erreichen Sie den Schadenregulierungsbeauftragten in Ihrem Urlaubsland und erhalten eine schnelle Auskunft zur Kfz-Haftpflichtversicherung Ihres Unfallgegners.

Um auf der sicheren Seite zu sein, empfiehlt es sich fast immer, die Polizei zu rufen. Lassen Sie sich von dieser nicht zu einem Schuldeingeständnis bewegen, aber bitten Sie um ein Unfallprotokoll. Für eine schnelle und bestmögliche Unfallregulierung ist es grundsätzlich von Vorteil, wenn Sie einen Anwalt hinzuziehen, der auf Verkehrsrecht spezialisiert ist. Die EINFINGER Anwaltskanzlei ist rund um die Uhr für Sie erreichbar und steht Ihnen nach einem Unfall im Ausland kompetent zur Seite.
Bildquellen: elements.envato..com, Adobe Stock
Unfall im Ausland: Was tun? | Zentralruf der Autoversicherer
Fälschungen von Oldtimern erkennen | Unseriöse Oldtimer-Händler erkennen | Mercedes 300 SL Oldtimer und andere teure Oldtimer sicher kaufen

Gefälschte Oldtimer: So unterscheiden Sie Fälschung und Original
Einen Oldtimer zu besitzen, ist für viele Menschen ein erstrebenswertes Ziel – zugleich aus nostalgischen und finanziellen Gründen. Denn für viele Oldtimer-Enthusiasten steht nicht nur der reine Fahrspaß im Vordergrund, es geht auch um eine Wertanlage. Diese lohnt sich besonders bei seltenen und beliebten Modellen, allerdings haben an diesen Exemplaren auch Fälscher und Betrüger ein verstärktes Interesse. Damit Sie keiner Fälschung zum Opfer fallen, erläutern wir im folgenden Blog-Artikel, wie Sie sich vor Oldtimer-Betrug schützen und welche Möglichkeiten Ihnen bei einer Fälschung zur Verfügung stehen.
Übersicht:
- Wie funktioniert eine Oldtimer-Fälschung?
- Welche rechtliche Grundlage gibt es beim Oldtimer-Betrug?
- Wie kann ich mich vor Oldtimer-Betrug schützen?
- Wie lässt sich eine Oldtimer-Fälschung feststellen?
- Wie kann mir ein auf Oldtimer-Fälschungen spezialisierter Anwalt weiterhelfen?
- Fazit: So umgehen Sie Oldtimer-Fälschungen
1. Wie funktioniert eine Oldtimer-Fälschung?
Oldtimer-Betrug kann vielseitige Formen annehmen. Das zeigt einerseits der Fall der gefälschten Mercedes 300 SL Roadster (W 198) rund um die Firma Kienle. Andererseits kam 2019 ein Fall um den Chef der inzwischen liquidierten Aachener Firma Scuderia M66 auf. Im Rahmen gewerbsmäßigen Betrugs sollen schrottreife Sport- und Rennwagen von Porsche, unter anderem der Porsche 911, eine Verwandlung in gefälschte Sammlerstücke durchlebt haben. Doch welche Maschen nutzen Fälscher und Betrüger, um die Oldtimerszene mit vermeintlichen Sammlerstücken zu untergraben? Um Ihnen einen Überblick zu geben, haben wir im Folgenden die häufigsten Betrugsmaschen kurz für Sie erläutert.

Fälschung der Fahrzeugdokumente
Bei der Fälschung von Oldtimern geht es darum, ihren vermeintlichen Wert in die Höhe zu treiben. Das gelingt unter anderem durch gefälschte Fahrzeugdokumente, die etwa eine seltene oder begehrte Ausstattung suggerieren, über die das Auto gar nicht verfügt. Zu dieser Masche zählt auch die Manipulation der Fahrzeugpapiere, um eine lückenlose Servicehistorie vorzutäuschen und Unfälle zu kaschieren. Um die Originalität des Wagens zu belegen, werden in manchen Fällen sogar Zertifikate von Oldtimer-Prüfstellen gefälscht.
Fälschung der Fahrgestellnummer
Neben den Papieren lässt sich auch die Fahrgestellnummer manipulieren. So verkaufen Betrüger etwa Fahrzeuge mit einer problematischen Geschichte. In einigen Fällen handelt es sich um gestohlene Autos, in anderen Fällen weist der Wagen Unfallschäden auf und in wieder anderen Fällen ist die notwendige Restaurierung nicht erfolgt. Die originale Nummernfolge tauschen Betrüger dabei gegen eine „saubere“ Nummer aus. Dieses Vorgehen ist auch dann hilfreich, wenn der Oldtimer als eine seltenere oder begehrtere Modellvariante an den Verkauf gehen soll.
Täuschung über den Fahrzeugzustand
Möchten Sie einen Oldtimer erwerben, sind Sie mit einem unabhängigen Wertgutachten immer auf der sicheren Seite. Denn manchmal stellen Verkäufer und Autohändler den Zustand des Fahrzeugs besser dar, als er in Wirklichkeit ist. Egal, ob Mercedes-Benz, Porsche, BMW oder VW: Bei den meisten Oldtimern spielt unter anderem Rost eine bedeutende Rolle. Sowohl im Hinblick auf den Wert als auch auf die Fahrsicherheit.
Mögliche Maschen sind das Kaschieren von Roststellen und das Herunterspielen des Korrosionsgrads. Auch Mängel am Fahrwerk, im Innenraum und an der Technik werden nicht selten unter den Teppich gekehrt. Um sich nicht über den tatsächlichen Fahrzeugzustand täuschen zu lassen, ziehen Sie am besten einen Gutachter oder einen auf gefälschte Oldtimer spezialisierten Anwalt hinzu.

Täuschung über die Fahrzeughistorie
Die Geschichte eines Wagens kann für seinen Wert entscheidend sein. Für Sammler ist eine Historie besonders wertvoll, wenn sie alle Fahrzeugdokumente, Rechnungen, Besonderheiten und eventuellen Rennerfolge umfasst. Um den Wert zu erhöhen, können Betrüger eine neue Geschichte erfinden oder ihnen eine geschönte Version vorlegen. Mögliche Beispiele sind die Erfindung einer gefälschten Renngeschichte und Behauptungen, dass prominente Personen einst im Besitz des Oldtimers waren. Sie schützen sich vor dieser Betrugsmasche am besten, indem Sie Expertenrat einholen und die Fahrzeughistorie unabhängig überprüfen lassen.
Einsatz von gefälschten Autoteilen
Für seltene, begehrte und wertvolle Oldtimer sind Original-Ersatzteile oft rar und durchaus kostenintensiv. Fälscher sparen Kosten, indem sie auf nicht originalgetreue und gefälschte Autoteile zurückgreifen. Häufig gehören die Teile nicht einmal zur ursprünglichen Ausstattung des Wagens. In einigen Fällen werden auch Motoren, Getriebe und andere bedeutende Bauteile ersetzt, um einen höheren Wert zu suggerieren.
Verkauf von gestohlenen Oldtimern
Um sich der Strafverfolgung zu entziehen, verkaufen Betrüger gestohlene Oldtimer oft international. Angenommen, Sie kaufen versehentlich einen gestohlenen Wagen, so kann Ihnen dieser im Nachhinein wieder entzogen werden. Um nicht auf eine solche Betrugsmasche hereinzufallen, empfiehlt es sich, die Fahrzeugdokumente genau zu überprüfen. Sie sollten außerdem einen genauen Blick auf die Fahrgestellnummer werfen, bei der zuständigen Zulassungsstelle oder bei internationalen Oldtimerregistern nachfragen.

Überteuerte Werkstattleistungen
Eine weitere Masche im Bereich des Oldtimer-Betrugs sind überteuerte Werkstattleistungen und Restaurierungsarbeiten. Betrüger unterbreiten Ihnen oftmals Angebote, die über vermeintliche Rabatte verfügen oder als preisgünstige Alternative in Aussicht gestellt werden. Ziel ist es, den Kunden zum Abschluss eines überteuerten oder nicht notwendigen Auftrags zu bewegen. In manchen Fällen kommen zusätzlich minderwertige Materialien und Autoteile zum Einsatz. Am besten schützen Sie sich vor solchen Betrugsversuchen, indem Sie mehrere Angebote einholen und diese sorgfältig miteinander vergleichen. Im Zweifelsfall stehen Sie mit einem auf Oldtimer spezialisierten Anwalt wie Alexander Einfinger auf der sicheren Seite.
Infobox: Warum lohnt es sich, einen Anwalt hinzuzuziehen?
Oldtimer-Fälschungen haben in den letzten Jahren zugenommen. Die Betrugsmaschen sind außerdem raffinierter geworden, sodass es nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich ist, ob ein Angebot wirklich seriös ist. Am besten schützen Sie sich, wenn Sie Kenntnisse über die häufigsten Maschen besitzen und beim Kauf Ihres Traumautos äußerste Vorsicht walten lassen.
Dennoch kommt es immer wieder zu Fällen der Fälschung. Im Zweifelsfall oder wenn Sie gute Gründe zur Annahme eines Betrugs haben, hilft Ihnen ein Anwalt mit Spezialisierung auf Oldtimer weiter. Er bespricht mit Ihnen das beste Vorgehen und steht Ihnen sowohl gerichtlich als auch außergerichtlich zur Seite, um Ihre Rechte durchzusetzen.
2. Welche rechtliche Grundlage gibt es beim Oldtimer-Betrug?
Bei Betrug handelt es sich um eine Straftat, bei der im Zusammenhang mit Oldtimern § 263 des Strafgesetzbuchs (StGB) greift. Er betrifft die Täuschung von Personen, der das Ziel zugrunde liegt, diese um den Wert des Fahrzeugs oder ihr Vermögen zu betrügen. Vermuten Sie einen Betrug oder eine Oldtimer-Fälschung, zeigen Sie dies am besten bei der zuständigen Polizeibehörde an. Es ist außerdem empfehlenswert, von Anfang an einen auf Oldtimer spezialisierten Anwalt hinzuzuziehen. Dieser unterstützt Sie im gesamten Fall und hilft Ihnen, Ihre Rechte durchzusetzen.
In zivilrechtlicher Hinsicht haben Sie als Geschädigter entweder Anspruch auf Schadensersatz oder können eine Rückabwicklung des Vertrags geltend machen. Welche rechtliche Möglichkeit sich für Ihren individuellen Einzelfall am besten eignet, besprechen Sie am besten mit Ihrem Anwalt. Dieser kann Ihren Fall detailliert einschätzen und Ihnen das für Sie beste Vorgehen empfehlen.

Anspruch auf Schadensersatz
Haben Sie einen Oldtimer erworben, kann es passieren, dass Sie einer Täuschung, einer Fälschung oder einem Betrug zum Opfer fallen. Wenn Sie einen zu hohen Preis gezahlt haben, können Sie Schadensersatz verlangen. Selbiges gilt, wenn Ihnen zusätzliche Kosten entstanden sind, die auf eine falsche Angabe des Fahrzeugzustands oder einer gefälschten Historie zurückzuführen sind. Ihr Anspruch auf Schadensersatz besteht sowohl bei direkten Schäden als auch bei entgangenen Gewinnen. Wurden Sie über den tatsächlichen Fahrzeugzustand getäuscht und kam es aufgrund dessen zu einem Unfall mit Verletzungen, können Sie zusätzlich einen Anspruch auf Schmerzensgeld geltend machen.
Rückabwicklung des Vertrages
Liegt eine Täuschung oder eine Fälschung vor, können Sie eine Rückabwicklung Ihres Kaufvertrags fordern. In diesem Fall sind beide Vertragsparteien dazu verpflichtet, die empfangenen Leistungen jeweils zurückzugewähren. Das bedeutet, als Käufer geben Sie das Fahrzeug an den Verkäufer zurück. Dieser erstattet Ihnen seinerseits den Kaufpreis. Die Rückabwicklung des Kaufvertrags ist allerdings nicht immer möglich. Beispielsweise wenn der Verkäufer insolvent ist, sich im Ausland aufhält oder die Gerichtsbescheide nicht zustellbar sind.

3. Wie kann ich mich vor Oldtimer-Betrug schützen?
Möchten Sie sich den Traum vom eigenen Oldtimer erfüllen, lohnt es sich, beim Kauf äußerste Sorgfalt walten zu lassen. Indem Sie ein paar Vorsichtsmaßnahmen und grundlegende Prinzipien beachten, schützen Sie sich vor Oldtimer-Fälschungen und Betrugsmaschen. Von Bedeutung sind unter anderem die folgenden Tipps:
- Überprüfen Sie Angebote für Ihren favorisierten Oldtimer sorgfältig. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Ihnen der Preis zu günstig oder zu hoch erscheint. Bleiben Sie außerdem skeptisch, wenn Ihnen zu hohe Versprechungen gemacht werden.
- Nehmen Sie eine detaillierte Prüfung der Fahrzeugdokumente vor und achten Sie auf Unstimmigkeiten. Beispiele sind gefälschte Stempel, handschriftliche Änderungen und Fahrgestellnummern, die nicht übereinstimmen.
- Bestehen Sie auf eine Probefahrt und lassen Sie sich beim Oldtimer-Kauf nicht unter Druck setzen. Achten Sie während der Probefahrt auf Motor, Fahrwerk und eventuelle Probleme.
- Ziehen Sie einen unabhängigen Gutachter hinzu oder beauftragen Sie eine Prüforganisation. Diese können nicht nur den Zustand des Fahrzeugs professionell überprüfen, sondern auch feststellen, ob Ersatzteile, Historie und Fahrgestellnummer einer Fälschung unterliegen.
- Informieren Sie sich über den aktuellen Mehrwert Ihres favorisierten Oldtimers und vergleichen Sie die Preise. So erkennen Sie besser, ob der Angebotspreis angemessen ist oder ob es sich um ein Lockangebot handelt.
- Recherchieren Sie bei internationalen Verkäufen die rechtlichen Grundlagen, die im jeweiligen Land gelten. Idealerweise beauftragen Sie einen Anwalt mit einer Spezialisierung auf Oldtimer und lassen sich fachgerecht beraten.

4. Wie lässt sich eine Oldtimer-Fälschung feststellen?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um einen Oldtimer als Fälschung zu entlarven. Im Zweifelsfall oder wenn ein Verdacht besteht, ziehen Sie am besten einen unabhängigen Gutachter oder Sachverständigen zurate. Dieser nimmt zunächst eine optische Prüfung vor. Reicht diese noch nicht aus, um den Verdacht zu bestätigen, erfolgen verschiedene Untersuchungen mit Spezialgeräten.
- Mithilfe einer Spektralanalyse lässt sich das Metall des Oldtimers analysieren. Die Analyse bestimmt den ungefähren Produktionszeitraum und legt diesen auf rund ein Jahrzehnt fest. Das Ergebnis gibt Hinweise darauf, ob der Oldtimer tatsächlich aus der Zeit stammt, in der er mutmaßlich gebaut wurde.
- Durch Ultraschall ist es möglich, die Dicke des Materials zu messen. Im Vordergrund steht hierbei die Lackschicht, denn diese kann Aufschluss über die Echtheit eines Oldtimers geben. Bei einem Porsche ist die Motornummer zum Beispiel an einem dünnen Steg eingeschlagen. Wird diese Nummer im Rahmen einer Fälschung herausgeschliffen und durch eine neue ersetzt, wird der Steg dünner.
- Bei Bedarf kommen weitere Prüfungsverfahren zum Einsatz, die Aufschluss über die Echtheit des Wagens geben. Grundsätzlich setzen Sachverständige immer die jeweils erforderliche Prüfung ein. Ist hingegen nichts über das Fahrzeug bekannt, kommen oftmals mehrere Prüfverfahren in Kombination zum Einsatz.
5. Wie kann mir ein auf Oldtimer-Fälschungen spezialisierter Anwalt weiterhelfen?
Für Laien ist es nicht immer ersichtlich, ob es sich bei einem Oldtimer um ein Original handelt. Selbst fachkundige Experten müssen teilweise detaillierte Prüfungen durchführen, um eine Fälschung als solche zu enttarnen. Indem Sie vor dem Kauf eines historischen Wagens einen auf Oldtimer spezialisierten Anwalt hinzuziehen, gehen Sie auf Nummer sicher und profitieren von einer wertvollen Unterstützung. Ein fachkundiger Experte berät Sie zunächst ausführlich und prüft die Sachlage. Zusätzlich vertritt er Sie bei Bedarf gerichtlich und außergerichtlich gegenüber der gegnerischen Partei. Er setzt Ihre Schadensersatzansprüche durch und unterstützt Sie, wenn Sie eine Rückabwicklung des Kaufvertrags erwirken möchten. Außerdem steht Ihnen ein Anwalt mit Spezialisierung auf Oldtimer zur Seite, wenn Dritte wie Gutachter oder Werkstätte in den Betrug involviert sind und arbeitet mit den Ermittlungsbehörden zusammen. Möchten Sie die Expertise eines auf Oldtimer spezialisierten Anwalts in Anspruch nehmen, steht Ihnen die Einfinger Anwaltskanzlei kompetent und bundesweit zur Seite. Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar und reagieren kurzfristig auf Ihre Anliegen rund um Verkehrsrecht, Oldtimer und Oldtimer-Betrug.

6. Fazit: So umgehen Sie Oldtimer Fälschungen
Wenn es um gefälschte Oldtimer geht, gibt es zahlreiche Betrugsmaschen. Zum Einsatz kommen gefälschte Fahrzeugpapiere, Fahrgestellnummer und Ersatzteile. Angebote nicht existenter Fahrzeuge, erfundene Historien und eine Täuschung über den tatsächlichen Fahrzeugzustand sind ebenfalls möglich. Hinzu kommen der Verkauf gestohlener Wagen und überteuerte Werkstattleistungen. Sind Sie Opfer einer Täuschung, einer Fälschung oder eines Betrugs geworden, greift § 263 StGB. Abhängig von Ihrem individuellen Einzelfall haben Sie Anspruch auf Schadensersatz oder können eine Rückabwicklung des Kaufvertrags geltend machen. Um gar nicht erst in die Falle von Fälschern und Betrügern zu tappen, ist eine Beratung durch einen Experten empfehlenswert. Im Idealfall ziehen Sie bereits vor dem Kauf eines Oldtimers einen unabhängigen Gutachter, Sachverständigen oder Anwalt mit Spezialisierung auf Oldtimer hinzu. Die Anwaltskanzlei Einfinger steht Ihnen bundesweit zur Seite und unterstützt Sie kompetent, wenn es um die Durchsetzung Ihrer Rechte geht. Sie erreichen uns rund um die Uhr und können sich auf eine zeitnahe Rückmeldung zu Ihrem Anliegen verlassen. Bildquellen: Adobe Stock, Envato Elements
Unfall im Ausland: Was tun? | Zentralruf der Autoversicherer
Punkte in Flensburg verhindern | Punktesystem in Flensburg verstehen | Punkte abfragen und abbauen | Anwalt für Verkehrsrecht als Unterstützung

7 praktische Tipps, um Punkte in Flensburg zu verhindern
Punkte in Flensburg können weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen: Sammeln sich im Laufe der Jahre acht oder mehr Punkte an, verlieren Sie Ihren Führerschein. Die Chance, eine neue Fahrerlaubnis zu erhalten, besteht frühestens nach sechs Monaten und nur unter der Voraussetzung, dass Sie Ihre Eignung für den Straßenverkehr nachweisen können. Wir haben deshalb sieben praktische Tipps für Sie, wie Sie Flensburger Punkte von vornherein vermeiden. Außerdem erklären wir Ihnen, was es mit diesem Punkteregister überhaupt auf sich hat, wie Sie gesammelte Punkte abbauen und Ihren aktuellen Punktestand abfragen.
Übersicht:
- Was sind Punkte in Flensburg?
- Wofür werden Punkte eingetragen?
- Welche Folgen haben Punkte in Flensburg?
- Wie lassen sich Punkte in Flensburg abfragen?
- Wie lassen sich Punkte in Flensburg abbauen?
- Lassen sich Punkte in Flensburg in der Probezeit abbauen?
- Werden Punkte nach der Löschung direkt aus dem Fahreignungsregister entfernt?
- Wie lassen sich Punkte in Flensburg verhindern?
- Fazit: So vermeiden Sie Punkte in Flensburg
1. Was sind Punkte in Flensburg?
Wer am Straßenverkehr teilnimmt, sollte sich an die Verkehrsregeln halten. Wer hingegen zu stark aufs Gaspedal tritt oder einen Rotlichtverstoß begeht, macht Bekanntschaft mit dem Bußgeldkatalog. Dieser hält fest, mit welchen Strafen ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung geahndet wird. Grundsätzlich sind Verwarnungen oder ein Bußgeldbescheid möglich. Ein Bußgeldbescheid enthält – abhängig von der Ordnungswidrigkeit oder Straftat – ein Bußgeld, ein Fahrverbot und Punkte, die in einem speziellen Register eingetragen werden.
Dieses sogenannte Fahreignungsregister wird vom Kraftfahrt-Bundesamt geführt. Der Sitz liegt in Flensburg im Bundesland Schleswig-Holstein. Im Volksmund sind die berüchtigten Punkte daher als Punkte in Flensburg bekannt.
2. Wofür werden Punkte eingetragen?
Im Straßenverkehr können Sie als Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer unterschiedliche Verstöße begehen. Erhalten Sie lediglich eine Verwarnung, kommen Sie ohne Punkte davon. Handelt es sich hingegen um eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße von mindestens 60 Euro einhergeht, kommen häufig Punkte auf Sie zu. Auch bei einem Fahrverbot und Verkehrsstraftaten werden diese in Flensburg eingetragen. Es gibt folgende Staffelung:
- 1 Punkt für Ordnungswidrigkeiten
- 2 Punkte für grobe Ordnungswidrigkeiten mit Regelfahrverbot oder Straftaten
- 3 Punkte für Straftaten, aufgrund derer Ihnen die Fahrerlaubnis entzogen wird

3. Welche Folgen haben Punkte in Flensburg?
Welche Konsequenzen Sie sich durch Punkte in Flensburg einhandeln, hängt vom Stand Ihres Punktekontos ab. Haben Sie einen Punktestand von ein bis drei Punkten, drohen Ihnen keine direkten Konsequenzen. Sie befinden sich noch im grünen Bereich und werden lediglich vorgemerkt. Allerdings haben Sie eine Eintragung im Fahreignungsregister, wodurch Sie bei einem späteren Vergehen nicht mehr damit argumentieren können, bisher nicht auffällig geworden zu sein. Daher kann es sich durchaus lohnen auch gegen den ersten Punkt vorzugehen.
Anders sieht es bei einem Punktestand von vier oder fünf Punkten aus. In diesem Fall erhalten Sie eine kostenpflichtige und schriftliche Ermahnung. Diese geht außerdem mit dem Hinweis einher, dass Sie alle fünf Jahre einen Punkt abbauen können, indem sie an einem Fahreignungsseminar teilnehmen. Die Ermahnung ist mit einer gelben Karte im Fußball vergleichbar.
Kritischer wird es, wenn Sie sechs oder sieben Punkte angesammelt haben. Der vorherigen Ermahnung folgt nun eine Verwarnung – ebenfalls schriftlich und kostenpflichtig. Auch bei diesem Punktestand erhalten Sie einen Hinweis auf die Teilnahme an einem Fahreignungsseminar. Allerdings können Sie Ihre Punkte durch die Teilnahme nicht mehr reduzieren, da der Punkteabbau nur bis zu einem Kontostand von fünf Punkten möglich ist.
Haben Sie Ihren achten Punkt in Flensburg gesammelt, erfolgt ein unmittelbarer Führerscheinentzug. Ihre Fahrerlaubnis sehen Sie frühestens nach einem halben Jahr wieder. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass Sie Ihre Eignung für den Straßenverkehr nachweisen können. Der Nachweis erfolgt in der Regel über ein medizinisch-psychologisches Gutachten.
Infobox: Vorteile bei fehlender Ermahnung und Verwarnung
Wenn Sie sechs oder sieben Punkte erreichen, zuvor aber keine Ermahnung erhalten haben, wird Ihr Punktestand auf fünf zurückgesetzt. Erreichen Sie acht oder mehr Punkte, ohne dass Sie vorher eine Verwarnung erhalten haben, reduziert sich Ihr Punktekonto auf sieben. Trotz dieser Regelung ist es nicht empfehlenswert, auf eine fehlende Ermahnung oder Verwarnung zu pokern.
4. Wie lassen sich Punkte in Flensburg abfragen?
Als Verkehrsteilnehmer können Sie Ihre Flensburger Punkte kostenfrei und jederzeit abfragen. Indem Sie Ihren Punktestand im Blick behalten, können Sie rechtzeitig über die Teilnahme an einem Fahreignungsseminar nachdenken und sich unter Umständen vor einem Führerscheinverlust schützen. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Auswahl:
- Sie bitten persönlich in den Dienststellen des Kraftfahrt-Bundesamtes um eine Auskunft über Ihren Punktestand. Die Dienststellen befinden sich in Dresden und Flensburg.
- Sie fragen Ihre Punkte schriftlich per Post ab.
- Sie nutzen die digitale Variante und bringen Ihren Punktestand digital über das Formular auf der Website des Amts oder über die Ausweis-App in Erfahrung.
Egal, für welche Variante Sie sich entscheiden: Die Abfrage ist immer kostenfrei. Lediglich bei einer Anfrage per Post zahlen Sie das Porto, wenn Ihnen die Dokumente auf dem Postweg zugeschickt werden.

5. Wie lassen sich Punkte in Flensburg abbauen?
Im Laufe der Zeit verfallen Punkte, die Sie in Flensburg angesammelt haben, automatisch. Es gelten folgende Fristen:
- 2,5 Jahre bei Ordnungswidrigkeiten mit 1 Punkt
- 5 Jahre bei Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten mit 2 Punkten
- 10 Jahre bei Straftaten mit 3 Punkten
Neben diesem passiven Punkteabbau können Sie Ihre Punkte aktiv reduzieren, indem Sie ein Fahreignungsseminar absolvieren. Die Teilnahme ist einmal innerhalb von fünf Jahren möglich und reduziert Ihren Punktestand um einen Punkt. Dieser aktive Punkteabbau ist allerdings nur möglich, wenn maximal fünf Punkte in Ihrem Fahreignungsregister eingetragen sind. Preislich liegt das kostenpflichtige Seminar zwischen 200 und 400 Euro. Eine Teilnahme ist unabhängig vom Punktestand nicht verpflichtend, kann Sie aber vor dem Verlust Ihrer Fahrerlaubnis bewahren.
6. Lassen sich Punkte in Flensburg in der Probezeit abbauen?
Auch innerhalb der Probezeit können Fahranfänger Punkte sammeln und diese durch den Besuch eines Fahreignungsseminars abbauen. Allerdings kommt diese Maßnahme in der Regel erst zum Einsatz, wenn sich das Punktekonto bereits mit mehreren Punkten gefüllt hat. Denn in der Probezeit spielen nicht nur Punkte, sondern vor allem A- und B-Verstöße eine tragende Rolle.
Begehen Sie in der Probezeit entweder drei A-Verstöße oder sechs B-Verstöße, verlieren Sie Ihre Fahrerlaubnis mindestens für ein halbes Jahr. Gleiches geschieht, wenn Sie eine Kombination aus A- und B-Verstößen ansammeln. Der Entzug der Fahrerlaubnis ist auch dann unvermeidbar, wenn der eigentliche Punktestand noch unterhalb von acht Flensburger Punkten liegt.
Zudem kommt es bereits bei einem A-Verstoß zu einer Verlängerung der Probezeit.
7. Werden Punkte nach der Löschung direkt aus dem Fahreignungsregister entfernt?
Im Laufe der Zeit bauen sich Ihre Flensburger Punkte von alleine wieder ab. Je nachdem, für welchen Verstoß Sie die Punkte erhalten haben, dauert dieser Prozess zwischen 2,5 und 10 Jahren. Allerdings verschwinden die Punkte nicht sofort aus dem Fahreignungsregister, nachdem sie gelöscht wurden. Stattdessen greift die sogenannte Überliegefrist. Sie ist der Grund, warum Ihre eingetragenen Punkte nach Ihrer Löschung für ein weiteres Jahr unsichtbar weiter existieren. Hintergrund der Überliegefrist ist die genaue Feststellung Ihres Punktestandes.
Beispiel: Sie haben bereits sieben Punkte gesammelt. Ein Punkt verjährt am 20. März, sodass Ihr Punktekonto auf sechs Punkte sinkt. Allerdings begehen Sie vor diesem Datum eine Ordnungswidrigkeit, für die Sie einen Flensburger Punkt erhalten. Ohne die Überliegefrist hätten Sie nun wieder einen Punktestand von sieben. Mit der Überliegefrist steht Ihr Punktekonto allerdings auf acht Punkten – weshalb Sie mit einem Führerscheinentzug rechnen müssen.

8. Wie lassen sich Punkte in Flensburg verhindern?
Tipp 1: Einspruch gegen Bußgeldbescheid erheben Punkte in Flensburg erhalten Sie ausschließlich über einen Bußgeldbescheid. Dieser Bescheid wird Ihnen zugestellt, wenn Sie im Straßenverkehr eine Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat begehen. Möchten Sie verhindern, dass ein Eintrag im Fahreignungsregister erfolgt, fechten Sie den Bußgeldbescheid an und erheben Einspruch.
Tipp 2: Begründeten Einspruch erheben In einem Strafverfahren gilt grundsätzlich, dass die Anklage einen Tatnachweis erbringen muss. Für ein verkehrsrechtliches Bußgeldverfahren gilt hingegen eine Beweislastumkehr, sodass Sie einen Beweis für Ihre Unschuld erbringen müssen. Hintergrund ist das standardisierte Messverfahren. Überfahren Sie eine rote Ampel oder treten Sie zu stark aufs Gaspedal und werden dabei geblitzt, gehen die Gerichte ohne Weiteres von einer einwandfreien Messung aus. Natürlich unter der Voraussetzung, dass die Messung auf einem geeichten Messgerät beruht, das von geschultem Messpersonal installiert wurde und dass die Messung bereits die vorgeschriebene Messtoleranz berücksichtigt.
Möchten Sie Einspruch gegen Ihren Bußgeldbescheid erheben, um die Eintragung von Punkten im Fahreignungsregister zu verhindern, brauchen Sie eine gute Begründung. Sie müssen konkrete Anhaltspunkte nennen, die auf einen Fehler im Messvorgang hindeuten oder plausibel darlegen, dass Sie zur Tatzeit nicht der Führer Ihres Fahrzeugs waren. Im Idealfall ziehen Sie einen auf Verkehrsrecht spezialisierten Anwalt hinzu. Dieser fachkundige Berater erhöht Ihre Erfolgschancen und unterstützt Sie bei der Darlegung von Beweisen für Ihre Unschuld.
Tipp 3: Akteneinsicht beantragen Um einen Fehler im Messverfahren nachzuweisen, benötigen Sie in der Regel eine umfassende Akteneinsicht. Sie liefert Ihnen erst die relevanten Unterlagen, die Sie zur Begründung Ihres Einspruchs benötigen. Können Sie auf Basis dieser Unterlagen keinen plausiblen Messfehler benennen, wird Ihr Einspruch häufig abgelehnt.
Als Betroffener kann es sehr schwer sein, eine umfassende Akteneinsicht zu erwirken. In der Regel wird diese nur Rechtsanwälten gewährt, insbesondere wenn es um die Bedienungsanleitung des Messgeräts und weitere spezifische Unterlagen geht. Auch in diesem Hinblick ist es deshalb empfehlenswert, einen erfahrenen Anwalt für Verkehrsrecht in Anspruch zu nehmen. Dieser unterstützt Sie nicht nur als Berater, sondern prüft Ihren individuellen Fall und erwirkt für Sie eine umfassende Akteneinsicht.
Tipp 4: Gutachten eines Sachverständigen in Anspruch nehmen Selbst wenn Sie einen Fehler in der Messtechnik vermuten, liegt dieser nur selten klar auf der Hand. Häufig fällt es gerade Betroffenen schwer, einen Messfehler plausibel zu begründen und die Fehlerquelle bei der teilweise sehr komplexen Messtechnik nachzuweisen. In diesem Fall kann Ihnen ein Gutachten eines Sachverständigen weiterhelfen. Dieser bewertet die Beweismittel, überprüft einerseits die Messtechnik als mögliche Fehlerquelle und analysiert auch das Beweisbild. Ein solches Gutachten ist für Sie als Betroffener mit einem erwähnenswerten Kostenrisiko verbunden. Verfügen Sie über eine Rechtsschutzversicherung, sind Sie im finanziellen Hinblick im Vorteil. Ebenso von Vorteil kann für Sie sein, dass die EINFINGER Anwaltskanzlei Kooperationspartner hat, mit denen das Kostenrisiko für Sie verringert werden kann.

Tipp 5: Besondere Umstände offenlegen Können Sie den Vorwurf, der Ihnen im Bußgeldbescheid unterbreitet wird, nicht von sich weisen, bleibt Ihnen häufig nur die Akzeptanz des Bescheids. Doch selbst wenn Sie die Ordnungswidrigkeit begangen haben, gibt es zahlreiche Konstellationen, die einen Punkteeintrag verhindern. Haben Sie den Verstoß unter besonderen Umständen begangen, lohnt es sich, diese offenzulegen. In einigen Fällen können Sie auf Basis dieser besonderen Umstände eine Milderung der Strafe erreichen, die Sie im besten Fall ohne Flensburger Punkte davonkommen lässt.
Tipp 6: Punkte verkaufen Eine rechtlich stark umstrittene Möglichkeit, um einen Punkteeintrag zu verhindern, ist das Verkaufen derselben. Hintergrund: Einige Verkehrssünder, denen aufgrund eines Verstoßes gegen die StVO ein Fahrverbot droht, kommen auf die Idee, ihre Strafe einfach an eine andere Person abzugeben. Dieses Vorgehen ist einerseits im Bekanntenkreis möglich und wird andererseits von speziellen Agenturen angeboten. Der eigentliche Verkehrssünder gibt seine Strafe, die im Bußgeldbescheid festgehalten ist, an eine andere Person ab. Diese gibt die Ordnungswidrigkeit über den Anhörungsbogen zu und übernimmt die Strafe. In der Folge kommt der eigentliche Verkehrssünder ohne einen Punkteeintrag im Fahreignungsregister davon.
Wichtig: Der Punktehandel ist illegal und per Gesetz nicht erlaubt. Sowohl der Punkte-Verkäufer als auch der Punkte-Käufer machen sich strafbar. In der Regel liegt als Tatbestand eine falsche Verdächtigung vor. Gemäß § 164 des StGB wird diese Tat mit einer Geldstrafe geahndet. Möglich ist auch eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. In der Folge ist von einem Punktehandel ausnahmslos abzuraten. Stattdessen empfiehlt es sich, den Punkteeintrag mithilfe der vorangegangenen Tipps zu verhindern.
Tipp 7: Einen Anwalt für Verkehrsrecht in Anspruch nehmen Wenn Sie verhindern möchten, dass Sie für eine Ordnungswidrigkeit einen Punkt in Flensburg erhalten, empfiehlt es sich, einen Anwalt für Verkehrsrecht in Anspruch zu nehmen. Ein Anwalt wie Alexander Einfinger berät Sie ausführlich zu Ihren Möglichkeiten und hilft Ihnen, die für Sie bestmögliche Strategie zu finden. Er legt für Sie begründeten Einspruch ein und erhöht Ihre Erfolgschancen erheblich.
Vor Gericht kann ein auf Verkehrsrecht spezialisierter Anwalt unter Umständen eine Reduzierung oder Aufhebung Ihrer Strafe erwirken. In der Folge kommen Sie mit der von Ihnen begangenen Ordnungswidrigkeit unter Umständen ohne einen Punkteeintrag davon. Auch wenn Sie besondere Gründe für den Verstoß vorbringen oder nachweisen können, dass Sie den Verstoß nicht begangen haben, erhalten Sie in der Regel keine Punkte.
Infobox: Rechtsschutzversicherte profitieren beim Hinzuziehen eines Anwalts finanziell
Indem Sie auf einen erfahrenen Anwalt wie Alexander Einfinger setzen, steht Ihnen ein fachkundiger Berater zur Seite. Haben Sie eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen, müssen Sie die Kosten für das gerichtliche Verfahren und Ihren Anwalt in der Regel nicht selbst tragen: Ihre Versicherung übernimmt den Betrag. Möglich ist es dennoch, dass Sie die vertraglich vereinbarte Selbstbeteiligung zu zahlen haben.

9. Fazit: So vermeiden Sie Punkte in Flensburg
Punkte in Flensburg erhalten Sie, wenn Sie gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen. Für eine Ordnungswidrigkeit erhalten Sie einen Punkt, für eine grobe Ordnungswidrigkeit mit Regelfahrverbot oder Straftaten erhalten Sie zwei Punkte und für Straftaten, die mit einem Entzug der Fahrerlaubnis einhergehen, erhalten Sie drei Punkte. Ihren Punktestand können Sie jederzeit kostenfrei über das Kraftfahrt-Bundesamt abfragen. Einmal innerhalb von fünf Jahren haben Sie die Möglichkeit, durch die Teilnahme an einem kostenpflichtigen Fahreignungsseminar einen Punkt abzubauen.
Haben Sie ein bis drei Punkte gesammelt, drohen Ihnen keine direkten Konsequenzen. Bei vier bis fünf Punkten werden Sie kostenpflichtig und schriftlich ermahnt, bei sechs bis sieben Punkten werden Sie verwarnt. Ab acht Punkten verlieren Sie Ihre Fahrerlaubnis für mindestens sechs Monate. Ihnen wird nur dann eine neue Fahrerlaubnis erteilt, wenn Sie Ihre Eignung für den Straßenverkehr durch ein medizinisch-psychologisches Gutachten nachweisen können.
Um Punkte in Flensburg zu vermeiden, dürfen diese gar nicht erst ins Fahreignungsregister eingetragen werden. Den Eintrag verhindern Sie, indem Sie begründeten Einspruch gegen Ihren Bußgeldbescheid erheben. Wichtig ist, dass die Strafe für die von Ihnen begangene Ordnungswidrigkeit aufgehoben oder so weit reduziert wird, dass sie keine Punkte mehr umfasst. Indem Sie einen erfahrenen Anwalt für Verkehrsrecht hinzuziehen, erhöhen Sie Ihre Erfolgschancen.
Bildquelle: unlimphotos.com, pixabay.com
Unfall im Ausland: Was tun? | Zentralruf der Autoversicherer
Rote Ampel überfahren: Diese Bußgelder drohen beim Rotlichtverstoß | Bei Rot über die Ampel fahren: Fahrverbot?

Wann darf ich eine rote Ampel überfahren, ohne dass eine Strafe droht?
Wenn Sie bei Rot über die Ampel fahren, kann sich das im Straßenverkehr als äußerst gefährlich erweisen. Neben möglichen Unfällen drohen auch Bußgelder und rechtliche Konsequenzen, da das Überfahren einer roten Ampel als schwerwiegender Verstoß gilt. Möglich sind neben der Geldbuße auch Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. Auch Fußgänger und Radfahrer sollten eine Ampel nicht bei Rot überqueren, denn auch ihnen drohen Bußgeld und Punkte. Selbst das Überqueren einer Kreuzung, nachdem die Ampel auf Gelb umgesprungen ist, kann ein Verwarnungsgeld nach sich ziehen. Was als Rotlichtverstoß gilt, welche Konsequenzen er mit sich bringt, in welchen Fällen sich ein Einspruch lohnt und wann juristischer Beistand sinnvoll ist, lesen Sie im Folgenden.
Übersicht:
- Wann liegt an einer Ampelanlage ein Verstoß vor?
- Welche Folgen hat das Überfahren einer roten Ampel?
- Welche Folgen hat das Überfahren einer roten Ampel in der Probezeit?
- Welche Regeln gelten an einer roten Ampel für Fußgänger und Radfahrer?
- Wie lässt sich ein Rotlichtverstoß feststellen?
- Bei welchen Ausnahmen ist das Überfahren einer roten Ampel erlaubt?
- Gibt es Gelblichtverstöße?
- Wann lohnt es sich, gegen einen Bußgeldbescheid bei einem Rotlichtverstoß Einspruch zu erheben?
- Wie lässt sich das Überfahren einer roten Ampel rechtfertigen?
- Wie kann ein Anwalt für Verkehrsrecht die Folgen eines Rotlichtverstoßes reduzieren?
- Fazit: Diese Regeln gelten bei einer roten Ampel
1. Wann liegt an einer Ampelanlage ein Verstoß vor?
Eine Ampelanlage setzt sich aus mehreren Bestandteilen zusammen. Neben der Ampel an sich gehören auch die Fahrbahnmarkierungen im Ampelbereich zur Anlage. Besonders wichtig ist die Haltelinie vor dem Kreuzungsbereich, die sich als breite weiße Linie auszeichnet. Sie entscheidet, wann ein Rotlichtverstoß vorliegt.
Ist die Ampel rot und überfahren Sie die Haltelinie mit der Vorderradachse Ihres Fahrzeugs, liegt ein Verstoß vor – egal, ob Pkw, Lkw, Motorrad oder Fahrrad. Halten Sie noch vor dem Kreuzungsbereich an, begehen Sie einen Haltelinienverstoß. Laut Bußgeldkatalog kostet Sie dieses Vergehen ein Bußgeld von 10 Euro. Fahren Sie hingegen in den Kreuzungsbereich ein, wird es deutlich teurer. In diesem Fall liegt ein Rotlichtverstoß vor, der als einfacher oder qualifizierter Verstoß Bußgeld, Punkte in Flensburg und möglicherweise ein Fahrverbot nach sich zieht.
Als Rotlichtverstoß gilt übrigens auch das Überfahren eines „Bei Rot hier halten“-Schildes. Dieser Fall tritt ein, wenn unmittelbar vor einer Ampelanlage eine Straße von rechts einmündet. In der Regel befindet sich vor der Einmündung eine Haltelinie auf der Hauptstraße, an der Sie bei roter Ampel anhalten müssen. Überfahren Sie diese Linie, begehen Sie einen Rotlichtverstoß. Ist keine Haltelinie auf der Hauptstraße vorhanden, gilt das Zusatzschild als Empfehlung, um anzuhalten. Halten Sie trotz dieser Empfehlung nicht an und es kommt zu einem Unfall, tragen Sie häufig die Teilschuld.
2. Welche Folgen hat das Überfahren einer roten Ampel?
Die Folgen eines Rotlichtverstoßes legt der Bußgeldkatalog fest. Wie hoch die Konsequenzen ausfallen, hängt davon ab, ob es sich um einen einfachen oder einen qualifizierten Rotlichtverstoß handelt:
- Einfacher Rotlichtverstoß: Sie überfahren die Ampel und diese ist weniger als eine Sekunde rot.
- Qualifizierter Rotlichtverstoß: Sie überfahren die Ampel und diese ist länger als eine Sekunde rot.
Begehen Sie einen einfachen Rotlichtverstoß, handeln Sie sich eine Geldbuße von 90 Euro und einen Punkt in Flensburg ein. Gefährden Sie beim Überfahren einer roten Ampel andere Verkehrsteilnehmer, zahlen Sie 200 Euro, erhalten zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot. Ein Unfall kostet sogar 240 Euro, zwei Punkte und ebenfalls ein einmonatiges Fahrverbot.
Handelt es sich um einen qualifizierten Rotlichtverstoß, setzt der Bußgeldbescheid 200 Euro Geldbuße, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot fest. Die Gefährdung anderer Teilnehmer erhöht das Bußgeld auf 320 Euro, eine Sachbeschädigung auf 360 Euro.
3. Welche Folgen hat das Überfahren einer roten Ampel in der Probezeit?
Haben Sie Ihren Führerschein erst seit kurzem und befinden sich noch in der Probezeit, gelten besonders strenge Vorschriften. Überfahren Sie als Fahranfänger eine rote Ampel, handeln Sie sich nicht nur eine Geldbuße und Punkte ein, sondern in den meisten Fällen auch eine Probezeitverlängerung und die Pflichtteilnahme an einem Aufbauseminar.
Entscheidend für die Konsequenzen ist die Einteilung der Ordnungswidrigkeiten in A- und B-Verstöße. Bei einem A-Verstoß verlängert sich Ihre Probezeit um zwei Jahre und Sie sind zur Teilnahme an einem Aufbauseminar verpflichtet. Ein B-Verstoß bringt keine direkten Folgen mit sich. Begehen Sie jedoch zwei B-Verstöße, drohen dieselben Konsequenzen wie bei einem A-Verstoß.
Wichtig: Das Überfahren einer roten Ampel als Fahranfänger wird immer als ein A-Verstoß eingestuft – auch wenn die Rotlichtzeit der Ampel unter einer Sekunde liegt. In der Probezeit kostet Sie ein einfacher Rotlichtverstoß somit ein Bußgeld, Punkte, eine Probezeitverlängerung und ein Aufbauseminar. Ein qualifizierter Rotlichtverstoß handelt Ihnen außerdem einen Monat Fahrverbot ein.
4. Welche Regeln gelten an einer roten Ampel für Fußgänger und Radfahrer?
Nicht nur Pkws, Lkws und Motorräder müssen an einer roten Ampel anhalten. Auch Fußgänger und Radfahrer dürfen die Anlage nur bei Grün überqueren. Halten Sie sich als Fußgänger nicht an die Straßenverkehrsordnung, zahlen Sie ein Verwarnungsgeld von fünf Euro. Verursachen Sie einen Unfall, erhöht sich die Geldbuße auf zehn Euro.
Als Radfahrer achten Sie auf die Ampeln der Autofahrer. Eine Ausnahme besteht, wenn Sie einer Radverkehrsführung folgen und diese über besondere Radfahrerampeln oder kombinierte Ampeln verfügt. Bei einem einfachen Verstoß zahlen Sie ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro, das sich bei Gefährdung auf 100 Euro und bei einem Unfall oder Sachbeschädigung auf 120 Euro steigert. Liegt ein qualifizierter Verstoß vor, zahlen Sie 100 Euro Bußgeld. Eine Gefährdung erhöht die Kosten auf 160 Euro und ein Unfall oder eine Sachbeschädigung erhöhen den Betrag auf 180 Euro. Bei beiden Verstößen erhalten Sie einen Punkt.
5. Wie lässt sich ein Rotlichtverstoß feststellen?
Stationäre Anlagen zur Überwachung Ist eine Ampel beim Überfahren rot, erhalten Sie meist einen Bußgeldbescheid, wenn Sie an der Ampel geblitzt werden. Um einen Rotlichtverstoß festzustellen, kommen am häufigsten Überwachungsanlagen zum Einsatz, die umgangssprachlich als Blitzer geläufig sind. Diese Anlagen blitzen Sie immer zweimal: Einmal beim Überfahren der Haltelinie und einmal beim Einfahren in den Kreuzungsbereich trotz roter Ampel.
Ursache für den doppelten Blitz sind zwei Induktionsschleifen: Eine ist direkt hinter der Haltelinie verbaut, die andere befindet sich in einem bestimmten Abstand zur ersten Induktionsschleife. Dieses Prinzip erlaubt es der Bußgeldstelle, Ihren Verstoß genau nachzuvollziehen. Die festgehaltenen Daten spiegeln wider, ob Sie nur die Haltelinie überfahren haben oder auch in den Kreuzungsbereich eingefahren sind.
Diese Messung ist wichtig, um zwischen einem einfachen und einem qualifizierten Rotlichtverstoß zu unterscheiden. Außerdem ist sie von Bedeutung, wenn es auf der Kreuzung zu einem Rückstau kommt. Denn fahren Sie bei Grün in die Kreuzung ein, müssen dort aber verkehrsbedingt anhalten, schaltet die Ampel hinter Ihnen möglicherweise auf Rot. Fahren Sie während der Rotphase weiter, löst die zweite Induktionsschleife aus und Sie werden geblitzt. Da der Messung lediglich ein Foto zugrunde liegt und die Induktionsschleife hinter der Haltelinie nicht ausgelöst hat, erkennt die Bußgeldstelle in der Regel, dass es sich nicht um einen von Ihnen verschuldeten Rotlichtverstoß handelt.
Infobox: Fahren Sie nicht zu schnell über eine Ampel
Stationäre Überwachungsanlagen stellen teilweise nicht nur einen Rotlichtverstoß fest, sondern messen auch die Geschwindigkeit, mit der Sie die Ampelanlage überqueren. Übertreten Sie die erlaubte Höchstgeschwindigkeit, um noch bei Grün oder Gelb über die Ampel zu kommen, handeln Sie sich womöglich einen Bußgeldbescheid wegen Geschwindigkeitsüberschreitung ein.
Zeugen
Neben stationären Überwachungsanlagen führen manchmal auch Polizisten oder Mitarbeiter des Ordnungsamtes eine gezielte Überwachung durch. Ein Beamter behält bei dieser Überwachung die Ampelanlage im Blick und beobachtet die Ampel zum Zeitpunkt des Phasenwechsels. Er achtet auch auf den Zeitpunkt, zu dem ein Fahrzeug über die Haltelinie rollt. Ein anderer Beamter misst die Zeit mit einer geeichten Stoppuhr. Zwar führen solche gezielten Überwachungen nicht selten zu Bußgeldbescheiden, doch lassen sich qualifizierte Verstöße vor Gericht nur selten durchbringen. In der Regel kann Ihnen lediglich ein einfacher Verstoß angelastet werden.

6. Bei welchen Ausnahmen ist das Überfahren einer roten Ampel erlaubt?
Rettungswagen im Einsatz Sind Sie im Straßenverkehr unterwegs und nähert sich ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Martinshorn, sind Sie dazu verpflichtet, auf der Fahrbahn schnellstmöglich Platz zu machen. Stehen Sie gerade an einer roten Ampel, kommen Sie dieser Verpflichtung häufig am besten nach, indem Sie in den Kreuzungsbereich einfahren oder diesen überqueren. In der Praxis begehen Sie also einen Rotlichtverstoß.
In der Regel wird Ihnen dieser Verstoß nicht angelastet. Da in den meisten Fällen auch das Einsatzfahrzeug kurz nach Ihnen geblitzt wird, erkennt die Bußgeldstelle solche Situationen recht problemlos. Trotzdem ist es empfehlenswert, Beweise für die Situation zu sammeln. Merken Sie sich einerseits das Kennzeichen des Rettungswagens und bitten Sie andererseits um die Kontaktdaten von Zeugen. Falls Sie einige Wochen später einen Anhörungsbogen erhalten, schildern Sie in diesem die genaue Situation und weisen die Einsatzfahrt nach.
Grüner Pfeil An manchen Ampelanlagen finden Sie ein Zusatzschild mit einem grünen Pfeil. Dieses Zeichen erlaubt es Ihnen, die Ampel während der Rotphase zu überfahren, ohne dass Ihnen eine Strafe droht. Bevor Sie abbiegen, behandeln Sie den grünen Pfeil allerdings wie ein Stoppschild: Sie halten an der Haltelinie an, beobachten die Verkehrslage und versichern sich, dass Ihr Weg frei ist. Achten Sie sowohl auf den Querverkehr als auch auf Radfahrer und Fußgänger. Unter Umständen ist an der Sichtlinie ein weiteres Mal zu halten. Erst anschließend passieren Sie die Haltelinie und biegen nach rechts ab.
Wichtig: Verhalten Sie sich in dieser Ausnahmesituation falsch und halten vor dem Abbiegen nicht an, begehen Sie einen Verstoß. Dieser kostet Sie ein Bußgeld zwischen 70 und 120 Euro sowie einen Punkt in Flensburg.

7. Gibt es Gelblichtverstöße?
Überfahren Sie bei Rot eine Ampel, begehen Sie einen Rotlichtverstoß. Aber: Beim Überfahren einer gelben Ampel begehen Sie ebenfalls einen Verstoß. Dieser Gelblichtverstoß fällt zwar deutlich milder aus, verpflichtet Sie aber dennoch zu einem Verwarnungsgeld von zehn Euro. Deshalb gilt: Springt die Ampel vor Ihnen von Grün auf Gelb, halten Sie lieber an, statt noch schnell über die Kreuzung zu brettern.
Wichtig: Drücken Sie bei einer gelben Ampel nicht aufs Gaspedal, um nicht anhalten zu müssen. Befindet sich ein Blitzer am Straßenrand, erhalten Sie möglicherweise einen zusätzlichen Bußgeldbescheid wegen Geschwindigkeitsüberhöhung.
8. Wann lohnt es sich, gegen einen Bußgeldbescheid bei einem Rotlichtverstoß Einspruch zu erheben?
Grundsätzlich können Sie gegen jeden Bußgeldbescheid, den Sie erhalten, Einspruch einlegen – egal, was Ihnen vorgeworfen wird. Empfehlenswert ist der Einspruch bei einem Rotlichtverstoß allerdings nur, wenn Sie den Bußgeldbescheid zu Unrecht erhalten haben oder eine falsche Messung vermuten. Um Ihre Chance zu erhöhen, ist es in jedem Fall ratsam, sich von einem Anwalt für Verkehrsrecht juristische Unterstützung zu holen.
Ein kompetenter Anwalt wie Alexander Einfinger beantragt für Sie Akteneinsicht, berät Sie umfassend zu Ihren Möglichkeiten und bespricht mit Ihnen das bestmögliche Vorgehen. Die juristische Unterstützung ist besonders von Vorteil, wenn Sie beim Überfahren einer roten Ampel erwischt wurden, da die Konsequenzen nicht gerade harmlos ausfallen.
9. Wie lässt sich das Überfahren einer roten Ampel rechtfertigen?
Haben Sie eine rote Ampel überquert und einen Bußgeldbescheid erhalten, können Sie Ihre Strafe häufig mit einer guten Rechtfertigung abmildern. In den meisten Fällen ist Ihre Chance höher, wenn Sie gleichzeitig einen auf Verkehrsrecht spezialisierten Anwalt hinzuziehen. Dieser prüft einerseits Ihren Bescheid und andererseits, ob die Messung fehlerfrei ist. Häufige Ursachen für einen Rotlichtverstoß sind unter anderem folgende:
- Unachtsamkeit des Fahrers
- Falsche Einschätzung der Gelbphase
- Nicht erkennbare Signalfarbe der Ampel aufgrund von ungünstiger Sonneneinstrahlung
- Defekter Blitzer oder defekte Ampel
- Rückstau auf der Kreuzung
Infobox: Rotlichtverstoß bei defekter Ampel
Es kann vorkommen, dass eine Ampel defekt ist und entweder dauerhaft rot bleibt oder die Ampelphasen nicht sichtbar anzeigt. Stehen Sie mehr als fünf Minuten an einer roten Ampel, ist es Ihnen nach dieser Wartezeit erlaubt, weiterzufahren. Dabei lassen Sie allerdings äußerste Vorsicht walten, beobachten den Verkehr genau und schließen aus, dass Sie andere Verkehrsteilnehmer gefährden.

10. Wie kann ein Anwalt für Verkehrsrecht die Folgen eines Rotlichtverstoßes reduzieren?
Wird Ihnen ein Rotlichtverstoß vorgeworfen und wollen Sie diesen Vorwurf inklusive der Konsequenzen nicht einfach hinnehmen, empfiehlt es sich immer, einen Anwalt für Verkehrsrecht in Anspruch zu nehmen. Dieser beantragt Akteneinsicht, analysiert die Situation und prüft Ihren Bußgeldbescheid. Als fachkundiger Berater steigert er außerdem Ihre Aussichten auf Strafmilderung.
Vor Gericht kann ein Anwalt wie Alexander Einfinger eine Milderung oder Aufhebung Ihrer Strafe erreichen. Ein drohendes Fahrverbot lässt sich zum Beispiel durch eine erhöhte Geldbuße ausgleichen, wenn Sie für Ihren Verstoß plausible Gründe vorbringen können. Wenn das Fahrverbot für Sie unzumutbare Folgen bedeutet, beispielsweise einen Verlust Ihres Arbeitsplatzes, lässt es sich in vielen Fällen umgehen. Liegt eine fehlerhafte Messung vor, kann Ihr Anwalt außerdem einen Freispruch für Sie erwirken oder Ihre Geldbuße reduzieren.
11. Fazit: Diese Regeln gelten bei einer roten Ampel
Überfahren Sie eine rote Ampel, wenn diese weniger als eine Sekunde lang Rot ist, begehen Sie einen einfachen Rotlichtverstoß. Liegt die Rotlichtzeit über einer Sekunde, handelt es sich um einen qualifizierten Verstoß. Im ersten Fall rechnen Sie mit einem Bußgeld zwischen 90 und 240 Euro sowie ein bis zwei Punkten in Flensburg. Im zweiten Fall liegt das Bußgeld zwischen 200 und 360 Euro, Sie handeln sich zwei Punkte ein und erhalten einen Monat Fahrverbot.
Nähert sich ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Martinshorn und müssen Sie diesem ausweichen, dürfen Sie bei Rot über eine Ampel fahren – im besten Fall achten Sie auf den Verkehr und fahren vorsichtig in den Kreuzungsbereich ein. Auch bei einem grünen Pfeil, der als Zusatzschild an manchen Ampeln angebracht ist, dürfen Sie die Ampel bei Rot überfahren. Behandeln Sie das Zusatzschild wie ein Stoppschild und halten Sie vor dem Abbiegen an. Ansonsten droht Ihnen ein Bußgeldbescheid.
Ein Rotlichtverstoß wird entweder durch eine stationäre Überwachungsanlage, auch Blitzer genannt, festgestellt oder durch Beamte, die eine gezielte Überwachung der Ampelanlage durchführen. Bei beiden Methoden können Fehler vorliegen. Erhalten Sie einen Bußgeldbescheid, prüfen Sie diesen genau. Haben Sie den Bescheid zu Unrecht erhalten oder vermuten Sie eine fehlerhafte Messung, können Sie Einspruch einlegen.
Möchten Sie Einspruch gegen den Vorwurf eines Rotlichtverstoßes einlegen, ist es ratsam, juristische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ein auf Verkehrsrecht spezialisierter Anwalt wie Alexander Einfinger erhöht Ihre Chancen und kann entweder eine Reduzierung der Konsequenzen oder eine Aufhebung der Vorwürfe erreichen. Ihr Anwalt beantragt für Sie Akteneinsicht, prüft Ihren Bußgeldbescheid und bespricht mit Ihnen das bestmögliche Vorgehen, um Ihre Strafe zu mildern oder ganz aufzuheben.
Bildquelle:
unlimphotos.com
Unfall im Ausland: Was tun? | Zentralruf der Autoversicherer
Unterschied von Verwarngeld und Bußgeld erklärt | Verwarnung vs. Bußgeldverfahren | Einspruch gegen Verwarnungsgeld erheben

Was ist der Unterschied zwischen Verwarngeld und Bußgeld?
Wenn Sie sich über deutsche Straßen bewegen, gilt die Straßenverkehrsordnung – egal, ob Sie als Fußgänger, Radfahrer, Pkw-Fahrer oder anderweitig am Verkehr teilnehmen. Wer sich nicht an die StVO hält, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die im Verkehrsrecht abhängig von der Schwere mit Verwarnung, Bußgeld, Punkten in Flensburg oder Fahrverbot bestraft wird. In Ausnahmefällen kann auch der Entzug der Fahrerlaubnis drohen. Welche Sanktionen bei einer Ordnungswidrigkeit gegen Sie verhängt werden, legt der Bußgeldkatalog fest. Er regelt zum einen die Höhe des zu entrichtenden Geldbetrags und bietet zum anderen eine Übersicht über mögliche Begleitsanktionen. Worum es sich bei Verwarngeld und Bußgeld genau handelt, wie sich beide Begriffe unterscheiden und wann sich juristischer Beistand empfiehlt, lesen Sie im Folgenden.
Übersicht:
- Was ist eine Verwarnung mit Verwarngeld?
- Welche Verstöße werden im Verkehrsrecht mit einer Verwarnung und Verwarnungsgeld geahndet?
- Wie läuft eine Verwarnung ab?
- Ist es möglich, eine Verwarnung mit Verwarngeld zu ignorieren?
- Ist es möglich, gegen eine Verwarnung Einspruch zu erheben?
- In welchen Fällen kann nach einer Verwarnung ein Bußgeldbescheid folgen?
- Was ist Bußgeld?
- Welche Verstöße werden im Verkehrsrecht mit einem Bußgeld geahndet?
- Wie ist der Verlauf eines Bußgeldverfahrens?
- Was passiert, wenn ein Bußgeldbescheid ignoriert wird?
- Ist es möglich, gegen einen Bußgeldbescheid Einspruch zu erheben?
- Fazit: So unterscheiden sich Verwarngeld und Bußgeld
- 13. FAQ
1. Was ist eine Verwarnung mit Verwarngeld?
Dürfte im Straßenverkehr jeder Teilnehmer machen, was er will, käme es mit Sicherheit zu einem absoluten Chaos. Um ebendieses zu vermeiden, existieren klare Richtlinien und Regeln, die das Verhalten im Straßenverkehr regeln. Dem Gesetzgeber ist es auf diese Weise möglich, gegen Verstöße vorzugehen und den jeweiligen Täter mit Sanktionen zu einem richtigen Verhalten im Straßenverkehr zu erziehen.
Wer gegen die Straßenverkehrsordnung verstößt, muss mit Sanktionen rechnen, die auf Basis des geltenden Bußgeldkatalogs ausgesprochen werden. Begehen Sie eine sogenannte geringfügige Ordnungswidrigkeit, wird diese in der Regel mit einer Verwarnung geahndet. Diese kann eine Zahlungsaufforderung beinhalten, wobei der zu entrichtende Betrag als sogenanntes Verwarngeld beziehungsweise Verwarnungsgeld bezeichnet wird.
Ob es sich um eine Ordnungswidrigkeit oder „nur“ eine geringfügige Ordnungswidrigkeit handelt, legt das deutsche Verkehrsrecht fest. Handelt es sich um eine Straftat, greift zudem das Verkehrsstrafrecht. Eine geringfügige Ordnungswidrigkeit sorgt dafür, dass Sie für Ihren Verstoß mit einem Verwarnungsgeld zwischen 5 und 55 Euro konfrontiert werden. Die Grundlage für diese Sanktion beruht auf § 56 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, kurz OWiG.
Eine geringfügige Ordnungswidrigkeit zeichnet sich durch kleine Regelverstöße aus, die nicht mit einer Gefährdung im Straßenverkehr oder einer starken Beeinträchtigung desselben einhergehen. Fällt der Verstoß gegen die StVO hingegen stärker aus und führt zu einer starken Beeinträchtigung oder Gefährdung im Straßenverkehr, handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit. Für diese werden Sie nicht mit einer Verwarnung sanktioniert, sondern mit einem Bußgeld.
Wichtig: Eine Verwarnung mit der Aufforderung zur Zahlung von Verwarngeld erhalten nicht nur Autofahrer. Es kann auch Radfahrer oder Fußgänger betreffen.
2. Welche Verstöße werden im Verkehrsrecht mit einer Verwarnung und Verwarnungsgeld geahndet?
Eine Verwarnung erhalten Sie im Verkehrsrecht, wenn Sie die StVO geringfügig verletzen. Unter anderem kann es sich um folgende Verkehrsverstöße handeln:
- Halte- und Parkverstöße
- Fahren ohne ein angebrachtes Kennzeichen
- Geschwindigkeitsüberschreitungen
- Abstandsverstöße
- Überladung des Fahrzeugs
- Bestehende Fahrzeugmängel
- Unzureichende Ladungssicherung
- Benutzung eines Handys auf dem Fahrrad
3. Wie läuft eine Verwarnung ab?
Verstoßen Sie als Verkehrsteilnehmer geringfügig gegen die Straßenverkehrsordnung und gibt es Zeugen für Ihren Verstoß, erhalten Sie eine Verwarnung. Diese wird Ihnen in Form eines Bescheids zugestellt oder Ihnen im ruhenden Verkehr direkt übermittelt, beispielsweise durch ein „Knöllchen“ an der Windschutzscheibe.
Haben Sie den umgangssprachlichen Strafzettel erhalten, besteht eine Zahlungsfrist von einer Woche, in der Sie das Verwarngeld bezahlen können. Haben Sie die Zahlung innerhalb der Frist geleistet, ist die Verwarnung abgeschlossen. Leisten Sie die Zahlung hingegen nicht, erhalten Sie im nächsten Schritt für gewöhnlich einen Bußgeldbescheid.
4. Ist es möglich, eine Verwarnung mit Verwarngeld zu ignorieren?
Theoretisch können Sie eine Verwarnung zur Seite legen und ignorieren. Dieses Verhalten ist jedoch in keinem Fall empfehlenswert. Lassen Sie die Zahlungsfrist unkommentiert verstreichen, eröffnet die zuständige Behörde ein Bußgeldverfahren gegen Sie. In der Folge erhalten Sie einen Bußgeldbescheid. Manchmal wird zuvor ein Anhörungsbogen verschickt. Durch Gebühren steigen die Kosten häufig an und aus dem ursprünglichen Geldbetrag der Verwarnung wird nicht selten ein ansehnliches Bußgeld.

5. Ist es möglich, gegen eine Verwarnung Einspruch zu erheben?
Nicht jeder Verkehrsteilnehmer ist damit einverstanden, wenn er verwarnt wird. Tatsächlich können Sie gegen eine Verwarnung – im Gegensatz zu einem Bußgeldbescheid - jedoch keinen direkten Einspruch einlegen. Möchten Sie sich wehren, können Sie nach § 56 OWiG Ihr Weigerungsrecht nutzen, wodurch die Verwarnung zunächst unwirksam wird.
In den meisten Fällen eröffnet die zuständige Behörde ein Bußgeldverfahren gegen Sie, wenn Sie die Zahlungsfrist der Verwarnung verstreichen lassen oder von Ihrem Weigerungsrecht Gebrauch machen. Es empfiehlt sich deshalb, die Chance zur Anhörung zu nutzen und Ihre Weigerung zu begründen. Im besten Fall wird das Verfahren zum Verwarnungsgeld gegen Sie eingestellt.
Meistens erhalten Sie hingegen einen Anhörungsbogen oder einen Bußgeldbescheid, der ein Bußgeldverfahren gegen Sie eröffnet. Das Verfahren erhöht in der Regel das zunächst niedrige Verwarnungsgeld, gibt Ihnen allerdings auch die Möglichkeit, formal Einspruch zu erheben. Möchten Sie die Sanktion anfechten, kann sich die Eröffnung eines Bußgeldverfahrens also als entscheidender Vorteil zeigen. Um Ihre Chance zu erhöhen, kann sich das Hinzuziehen eines Anwalts lohnen, der Sie bei Bedarf auch vor Gericht vertritt.
Infobox: Deshalb lohnt es sich, juristische Hilfe in Anspruch zunehmen
Haben Sie eine Verwarnung oder einen Bußgeldbescheid erhalten, lohnt es sich in vielen Fällen, einen Anwalt für Verkehrsrecht um Unterstützung zu bitten. Dieser prüft einerseits die Verwarnung beziehungsweise den Bußgeldbescheid auf Richtigkeit und steht Ihnen andererseits zur Seite, wenn Sie Einspruch erheben möchten. Der juristische Beistand erhöht Ihre Chancen, dass die Verwarnung beziehungsweise das Bußgeld zurückgezogen wird. Vor allem in Fällen, in denen die Klärung Ihrer Schuld oder Unschuld eines Gutachtens bedarf, ist die Kontaktaufnahme mit einem spezialisierten Anwalt wie Alexander Einfinger sehr empfehlenswert.
6. In welchen Fällen kann nach einer Verwarnung ein Bußgeldbescheid folgen?
Sie haben eine Verwarnung erhalten, zahlen das Verwarnungsgeld aber nicht fristgerecht – entweder weil Sie es nicht möchten, nicht können oder schlichtweg vergessen haben. Die zuständige Behörde kann daraufhin ein Bußgeldverfahren gegen Sie eröffnen und Ihnen in einem ersten Schritt einen Anhörungsbogen zukommen lassen. Der Grund: Die Behörde geht davon aus, dass Sie die Verwarnung ablehnen.
Haben Sie das Verwarngeld gezahlt, kann es aus folgenden Gründen trotzdem zu einem Bußgeldbescheid kommen:
- Ihre Zahlung geht außerhalb der einwöchigen Frist bei der Behörde ein.
- Ihre Zahlung kam nicht bei der Behörde an oder der Betrag war zu gering.
- Sie haben entweder das falsche oder gar kein Aktenzeichen angegeben und Ihre Zahlung konnte nicht zugeordnet werden.
Sollten Sie vollständig gezahlt haben, lassen Sie der zuständigen Behörden einen entsprechenden Beleg über Ihre Zahlung zukommen, beispielsweise einen Kontoauszug. Alternativ legen Sie gegen den Bußgeldbescheid Einspruch ein.

7. Was ist Bußgeld?
Das sogenannte Bußgeld verfolgt im Verkehrsrecht eine lange Tradition. Die Geldbuße sowie weitere Maßnahmen, zu denen unter anderem Punkte in Flensburg, ein Fahrverbot oder ein Entzug der Fahrerlaubnis gehören, verfolgen dasselbe Ziel: Wer im Straßenverkehr eine Ordnungswidrigkeit begeht, soll durch die Sanktionen davon abgehalten werden, denselben Verstoß zu wiederhohlen oder einen anderen Verstoß zu begehen. Die Sanktionen verfolgen also eine erzieherische Wirkung.
Um die Sanktionen gegen Verstöße im Straßenverkehr transparent zu gestalten, gibt es einen bundeseinheitlichen Bußgeldkatalog, der alle möglichen Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr auflistet. Er weist jedem Verstoß eine Tatbestandsnummerierung und eine Strafe zu, die sich jeweils nach der Schwere des Vergehens richtet. Grundsätzlich können folgende Sanktionen auf Sie zukommen, wenn Sie mehr als geringfügig gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen:
- Bußgeld
- Punkte in Flensburg
- Fahrverbot
- Entzug der Fahrerlaubnis
Werden Sanktionen gegen Sie erhoben, erhalten Sie einen Bußgeldbescheid. Dieser enthält neben der reinen Geldbuße häufig weitere Kostenpunkte, die aufgrund der Gebühren und Auslagen der Behörde anfallen. Laut § 107 OWiG liegt der Betrag zwischen 25 und 7.500 Euro. Eine Akteneinsicht während des Bußgeldverfahrens kostet zusätzlich 12 Euro und reduziert sich bei einer elektronischen Übermittlung auf 5 Euro.
Infobox: Einem Bußgeld muss keine Verwarnung vorausgehen
Viele Verkehrsteilnehmer vertreten die Ansicht, dass zuerst eine Verwarnung erfolgen muss, bevor ein Bußgeldverfahren eröffnet wird. Diese Ansicht erweist sich jedoch als Irrtum: Wenn Sie eine Ordnungswidrigkeit begehen, können Sie direkt mit einem Bußgeld bestraft werden, ohne dass Sie zuvor verwarnt werden.
9. Wie ist der Verlauf eines Bußgeldverfahrens?
Haben Sie im Straßenverkehr eine Ordnungswidrigkeit begangen, erhalten Sie auf dem Postweg zunächst einen Anhörungsbogen. Dieser bietet Ihnen die Möglichkeit, sich zum jeweiligen Vorwurf zu äußern und die Ordnungswidrigkeit entweder zuzugeben oder Einspruch zu erheben. Geben Sie die Ordnungswidrigkeit zu, erhalten Sie im nächsten Schritt einen Bußgeldbescheid.
Dieser Bescheid schildert noch einmal die Tat, die Ihnen vorgeworfen wird, und setzt den Betrag fest, zu dessen Zahlung Sie aufgefordert werden. Abhängig von der Schwere der Ordnungswidrigkeit können begleitende Maßnahmen wie Punkte oder ein Fahrverbot vermerkt sein. Sobald Sie das Bußgeld bezahlen, gilt das Verfahren als abgeschlossen. Zahlen Sie das Bußgeld nicht oder erheben Sie Einspruch gegen das Verfahren, erhalten Sie entweder eine Mahnung von der zuständigen Behörde oder diese stellt weitere Ermittlungen an, um Ihre Schuld beziehungsweise Unschuld festzustellen.
10. Was passiert, wenn ein Bußgeldbescheid ignoriert wird?
Haben Sie einen Bußgeldbescheid erhalten, sollten Sie diesen nicht ignorieren. Zwar ist es straflos möglich, den Anhörungsbogen ohne Kommentar zur Seite zu legen – vorausgesetzt, alle enthaltenen Daten zu Ihrer Person sind korrekt. Allerdings ist dieses Vorgehen bei einem Bußgeldbescheid nicht empfehlenswert. Der Grund: Bei einem Bescheid über ein Bußgeld handelt es sich um einen sogenannten Verwaltungsakt. Die Wirkkraft des Bescheids lässt sich deshalb mit einem richterlichen Beschluss vergleichen.
Lassen Sie die Zahlungsfrist verstreichen und erheben Sie auch keinen Einspruch gegen den Bescheid, erhalten Sie von der zuständigen Behörde mehrere Mahnungen. Ignorieren Sie den Bußgeldbescheid weiterhin, kommen zusätzliche und in der Regel strengere Sanktionen auf Sie zu. Diese beginnen bei einer weiteren Geldstrafe und reichen im schlimmsten Fall bis zu einer Freiheitsstrafe. Indem Sie einem Bescheid keine Beachtung schenken, genießen Sie keinerlei Vorteile. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie sich verhalten sollen, oder wenn Sie Einspruch erheben möchten, ist es empfehlenswert, einen spezialisierten Anwalt wie Alexander Einfinger zurate zu ziehen. Als erfahrener Anwalt für Verkehrsrecht steht er Ihnen zur Seite und unterstützt Sie als juristischer Beistand.
Infobox: Ignorieren Sie keinen Bußgeldbescheid, weil Sie das Bußgeld nicht zahlen können
Haben Sie einen Bußgeldbescheid erhalten, können den festgesetzten Betrag aber nicht zahlen, ist das Ignorieren des Bescheids keine Lösung. Stattdessen wenden Sie sich lieber an die zuständige Behörde und vereinbaren mit dieser eine Ratenzahlung. So vermeiden Sie Mahngebühren und ein Bußgeld, das stetig in die Höhe klettert, während Sie den Bescheid ignorieren.

11. Ist es möglich, gegen einen Bußgeldbescheid Einspruch zu erheben?
Wurde gegen Sie ein Bußgeldverfahren eröffnet, etwa wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung oder weil Sie eine rote Ampel überfahren haben, können Sie gegen den Tatbestand Einspruch einlegen. Sie haben zwei Wochen Zeit, um Ihren Widerspruch der zuständigen Behörde mitzuteilen. Entweder legen Sie selbst Einspruch ein oder Sie ziehen einen Spezialisten für Verkehrsrecht hinzu, der Sie juristisch betreut und Ihre Erfolgschancen erhöht.
Wenn die Behörde Ihrem Einspruch stattgibt, werden die Sanktionen gegen Sie entweder reduziert oder vollkommen aufgehoben. Allerdings kann es auch zum Gegenteil kommen und das Bußgeld sowie mögliche Begleitstrafen erhöhen sich. Das ist beispielsweise dann möglich, wenn weitere Ermittlungen oder ein Gutachten darauf hinweisen, dass Ihre Ordnungswidrigkeit schlimmere Folgen nach sich gezogen hat, als zunächst angenommen wurde.
In diesem Fall kann es sein, dass Sie die Gerichtskosten, die durch den Einspruch gegen das Bußgeldverfahren entstehen, selbst zahlen müssen. Zusätzlich entstehen unter Umständen weitere Kosten, etwa für ein Gutachten. Aus dem ursprünglichen Bußgeld kann sich im Laufe des Verfahrens ein beachtlicher Betrag entwickeln. Bei einem Einspruch mit einem Anwalt für Verkehrsrecht Rücksprache zu halten, ist deshalb sehr empfehlenswert. Prüfen Sie auch, ob Ihre Rechtsschutzversicherung die Kosten trägt. Regelmäßig werden sogar Gutachten von ihr gezahlt.
Infobox: Ist es sinnvoll, den Bußgeldbescheid und die Höhe des Bußgeldes durch einen spezialisierten Rechtsanwalt überprüfen zu lassen?
In einer Bußgeldstelle arbeiten Menschen und diesen können Fehler unterlaufen. In Deutschland werden sogar regelmäßig Bußgeldbescheide verschickt, die formale Fehler beinhalten oder unrechtmäßig sind. Besonders wenn die Sanktionen eine höhere Geldbuße oder weitere Begleitsanktionen wie Punkte in Flensburg oder ein Fahrverbot umfassen, lohnt sich die genaue Überprüfung des Bescheides. Mit einem auf Verkehrsrecht spezialisierten Anwalt können Sie Ihren Anhörungsbogen oder Bußgeldbescheid besprechen und festgestellte Fehler zur Begründung Ihres Einspruchs nutzen.
12. Fazit: So unterscheiden sich Verwarngeld und Bußgeld
Verstoßen Sie im Verkehr gegen die Straßenverkehrsordnung, kommen entweder ein Verwarngeld oder ein Bußgeld auf Sie zu. Eine Verwarnung erhalten Sie für nur geringfügige Verstöße, einen Bußgeldbescheid hingegen für erhebliche Ordnungswidrigkeiten. Ein Verwarnungsgeld liegt bei in einer Höhe zwischen 5 und 55 Euro. ein Bußgeld kann darüber hinausgehen.
Verwarnung und Bußgeldbescheid beruhen beide auf den Grundlagen des Ordnungswidrigkeitengesetzes, kurz OWiG. Die jeweilige Höhe und eventuelle Begleitsanktionen hält der Bußgeldkatalog fest, wobei der zuständigen Behörde ein gewisser Spielraum für die individuelle Strafe zur Verfügung steht.
Eine geringfügige Ordnungswidrigkeit geht ohne eine Gefährdung im Straßenverkehr einher und beeinträchtig diesen nicht weiter. Eine erhebliche Ordnungswidrigkeit ist hingegen mit einer Gefährdung verbunden und kann zu einer starken Beeinträchtigung des Straßenverkehrs führen.
Zahlen Sie das Verwarnungsgeld nicht innerhalb der einwöchigen Frist, kann die zuständige Behörde ein Bußgeldverfahren gegen Sie eröffnen. Bei einem Bußgeld kommen im Gegensatz zu einem Strafzettel weitere Kosten auf Sie zu, die sich etwa durch Gebühren und Umlagen der jeweiligen Behörde ergeben.
13. FAQ
Lesen Sie im Folgenden einige der häufigsten Fragen und Antworten rund um das Thema Verwarngeld und Bußgeld:
Wie unterscheidet sich Bußgeld innerorts und außerorts? Die Höhe einer Geldbuße orientiert sich unter anderem an der Gefährdung, die der Verstoß auf den Verkehr ausübt. Verstöße fallen innerorts potenziell gefährdender aus als außerorts. Handelt es sich beispielsweise um eine Geschwindigkeitsüberschreitung, ist das Risiko, andere Verkehrsteilnehmer zu verletzen oder eine Sache zu beschädigen, innerhalb einer Ortschaft höher als außerhalb. Deshalb werden Verstöße außerorts mit einer höheren Geldbuße geahndet als innerorts.
Was passiert, wenn ich ein Verwarngeld oder Bußgeld nicht zahlen kann? Im Bußgeldkatalog sind teilweise auch hohe Geldbußen definiert, die nicht jeder Fahrer oder Verkehrsteilnehmer zahlen kann. Wenn Sie ein Verwarnungsgeld oder Bußgeld nicht zahlen können, besteht die Möglichkeit, mit der zuständigen Behörde eine Ratenzahlung zu vereinbaren.
Können Verwarngeld und Bußgeld verjähren?
Ordnungswidrigkeiten verjähren in Deutschland nach einer gewissen Zeit. Die Verjährung soll sicherstellen, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt nach dem Verkehrsverstoß Rechtsfrieden herrscht. Nach § 26 Absatz 3 StVG verjähren Geldbußen innerhalb von drei Monaten, wenn Sie in diesem Zeitraum weder eine Verwarnung noch einen Anhörungsbogen noch einen Bußgeldbescheid erhalten.
Wollen Sie mehr über das Thema Verkehrsrecht erfahren? Dann schauen Sie sich diese informativen Ratgeber an!
- Anhörung im Bußgeldverfahren: 7 Verhaltenstipps vom Anwalt
- Vorwurf der Fahrerflucht? Was Sie dazu wissen sollten - Hinweise vom Anwalt
- Fahrverbot umgehen - 4 Tipps vom Anwalt für Verkehrsrecht
Bildquelle:
www.unsplash.com
Unfall im Ausland: Was tun? | Zentralruf der Autoversicherer
SIXT Carsharing will Ihnen einen Schaden anhängen? | So verhalten Sie sich richtig | Tipps vom Anwalt | Jetzt Mobilrechtler.de-Blog lesen!

Wie verhalte ich mich richtig, wenn mir SIXT Carsharing einen Schaden anhängen möchte?
Carsharing ist eine beliebte und praktische Möglichkeit, mobil zu sein, ohne ein eigenes Auto zu besitzen. Sie können jederzeit ein Fahrzeug in Ihrer Nähe mieten, das zu Ihren Bedürfnissen passt, und es nach Gebrauch einfach wieder am Zielort abstellen. Einer der größten Anbieter von Carsharing in Deutschland ist SIXT Share, der Teil der bekannten Autovermietung SIXT ist. So weit, so gut. Doch was tun, wenn SIXT Carsharing Ihnen nach der Miete zu Unrecht einen Schaden anhängen möchte? Wie kann Ihnen ein erfahrener Anwalt dann dabei helfen, Ärger und Kosten zu vermeiden? In diesem Ratgeber erfahren Sie, wie Sie sich in diesen Fällen richtig verhalten - und wo Sie kompetente Hilfe herbekommen.
Übersicht:
- SIXT Share - was ist das überhaupt?
- Welche Schutzoptionen gibt es bei SIXT Share?
- Wie sichere ich mich am besten für einen Unfall bei SIXT Share ab?
- Wie sollte ich reagieren, wenn wirklich ein Unfall mit meinem Mietwagen bei SIXT Share passiert ist?
- Was kann ich tun, falls mir SIXT nachträglich einen Schaden anhängen will?
- Wie kann ich beweisen, dass ich einen SIXT Schaden nicht verursacht habe?
- Wie kann mir ein Anwalt für Verkehrsrecht dabei helfen, mich gegen Vorwürfe von SIXT zur Wehr zu setzen?
- Mobilrechtler.de - Ihre erste Adresse bei Streitfällen mit SIXT Share
1. SIXT Share - was ist das überhaupt?
SIXT Share ist ein minutenbasiertes Carsharing-Angebot von SIXT, das seit 2019 in Deutschland (Berlin. München und Hamburg) verfügbar ist. Mit SIXT Share wird das sogenannte "Städte-Hopping" zum Kinderspiel. Das unterscheidet den Dienst von anderen Carsharing-Anbietern, die oft auf die unmittelbare Umgebung beschränkt sind. Möglich ist das Abstellen eines SIXT-Share-Fahrzeugs in ganz Deutschland, solange es sich um einen der Geschäftsbereiche von SIXT handelt. So können Sie mit dem Anbieter beispielsweise vom Alexanderplatz in Berlin zur Elbphilharmonie in Hamburg fahren. Das macht das eigene Auto überflüssig. Das gewünschte Fahrzeug findet man in der Regel gleich um die Ecke oder zumindest in der nächstgrößeren Straße. Die Registrierung per App ist kostenlos und es ist einfach, spontan ein neues Auto zu mieten und sofort loszufahren. Alles mit dem Smartphone. Inklusive sind: 200 Kilometer, Benzinkosten und die Parkgebühren.
Kleiner Tipp: Für Kunden, die sich besonders viel Zeit nehmen möchten, bietet SIXT Share Stunden- und Tagespakete an. Dabei spart man schon vor Fahrtbeginn bares Geld auf den sonst üblichen Minutenpreis beim Carsharing von Stadt zu Stadt. Die Stunden- und Tagespakete lösen das Problem der Minutenpreise. Oft möchte man keine langen Strecken fahren, aber das Auto weiterhin zur Verfügung haben, um an einen See oder zu Ikea zu fahren. Das Carsharing von Stadt zu Stadt ist derzeit in fast 50 Kombinationen möglich. Wer "Städte-Hopping" betreibt, zahlt zusätzlich eine "Einweggebühr".
INFO: So beliebt ist Carsharing in Deutschland
Carsharing ist in Deutschland ein wachsender Trend, der vor allem von jungen, urbanen, umweltbewussten und technikaffinen Menschen genutzt wird (“Early Adopters”.). Laut einer Studie des Bundesverbands CarSharing e.V. (bcs) gab es Ende 2020 rund 2,3 Millionen Carsharing-Nutzer in Deutschland, die auf über 85.000 Fahrzeuge zugreifen konnten. Das entspricht einem Zuwachs von 12,5 Prozent bei den Nutzern und 8,2 Prozent bei den Fahrzeugen im Vergleich zum Vorjahr. Die meisten Carsharing-Nutzer gibt es in Berlin (435.000), gefolgt von Hamburg (205.000), München (165.000) und Köln (115.000). Die höchste Fahrzeugdichte hat Karlsruhe mit 5,1 Fahrzeugen pro 1.000 Einwohner, gefolgt von Freiburg (4,6) und Stuttgart (4,4). Die beliebtesten Carsharing-Anbieter sind neben SIXT Share Share Now, Miles, WeShare, Cambio oder Flinkster.
2. Welche Schutzoptionen gibt es bei SIXT Share?
- Basic: Mit dieser Option zahlen Sie keine zusätzlichen Gebühren, aber Ihre Selbstbeteiligung bleibt bei einem bestimmten Betrag pro Schaden erhalten (außer bei Premiumfahrzeugen).
- Smart: Mit dieser Option zahlen Sie eine überschaubare Gebühr auf Stunden- oder Tagesbasis und Ihre Selbstbeteiligung sinkt auf 0 Euro pro Schaden (außer bei Premium-Autos).
Die Preise der Schutzoptionen “Basic” und “Smart” hängen von der Mietoption, der Fahrzeugkategorie und dem Fahrzeugwert ab. Sie können die Preise in der SIXT App einsehen. Praktisch: Sie können Ihre bevorzugte Selbstbeteiligung für zukünftige Fahrten in der App speichern, damit die Schutzoption automatisch hinzugefügt wird.
Kleiner Tipp: So sparen Sie bei längeren Fahrten Wenn Sie mal länger unterwegs sind, können Sie bei SIXT Share auch bei den Schutzoptionen von speziellen Stunden- und Tagespaketen profitieren. Das bedeutet, dass Sie die Schutzoption zu einem festen Preis hinzubuchen können, wenn Sie ein Stunden- oder Tagespaket für das Fahrzeug wählen. Das ist günstiger als der Minutenpreis und Sie wissen schon vorher, wie viel Sie zahlen müssen. Beachten Sie aber, dass Sie nicht verbrauchte Minuten nicht erstattet bekommen und dass Sie nach Ablauf des Pakets minutenbasiert abgerechnet werden.
INFO: Was sind die Vorteile von Carsharing?
Carsharing bietet viele Vorteile für die Nutzer, die Umwelt und die Gesellschaft. Zu den Vorteilen gehören:
- Kostenersparnis: Carsharing ist oft günstiger als ein eigenes Auto zu besitzen, da Sie nur für die Nutzung zahlen und keine Fixkosten wie Steuern, Versicherung, Wartung oder Parkgebühren haben. Laut einer Studie des ADAC können Sie mit Carsharing bis zu 1.000 Euro pro Jahr sparen, wenn Sie weniger als 10.000 Kilometer pro Jahr fahren.
- Flexibilität: Das Sharing bietet Ihnen die Möglichkeit, jederzeit ein Fahrzeug zu wählen, das zu Ihrem Bedarf passt. Sie können zwischen verschiedenen Modellen, Größen und Ausstattungen wählen und das Auto an verschiedenen Orten abholen und abstellen. Sie sind nicht an feste Zeiten oder Verträge gebunden und können jederzeit spontan und kurzfristig agieren.
- Umweltschutz: Carsharing trägt zum Umweltschutz bei, da es den Fahrzeugbestand und den Verkehr reduziert. Laut einer Studie des Umweltbundesamts ersetzt ein Carsharing-Fahrzeug bis zu 20 private Pkw und spart bis zu 30 Tonnen CO2 pro Jahr ein. Außerdem sind Carsharing-Fahrzeuge oft neuer, sparsamer und emissionsärmer als ältere private Pkw.
- Gesellschaftlicher Nutzen: Autos zu teilen fördert den gesellschaftlichen Nutzen, da es die Mobilität und die Lebensqualität erhöht. Carsharing-Nutzer sind oft multimodal unterwegs, das heißt, sie kombinieren verschiedene Verkehrsmittel wie öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad oder Fußwege. Das ist gesund und führt zu einer geringeren Lärmbelastung sowie einer höheren Attraktivität der Innenstädte. Außerdem fördert Carsharing die soziale Interaktion und die Teilhabe, da es den Zugang zu Mobilität für alle ermöglicht.
3. Wie sichere ich mich am besten für einen Unfall bei SIXT Share ab?
Um sich für einen Unfall bei SIXT Share abzusichern, sollten Sie einige Punkte beachten, bevor Sie ein Fahrzeug mieten und losfahren. Dazu gehören:
- Wählen Sie die passende Schutzoption: Wie bereits erwähnt, können Sie bei SIXT Share zwischen verschiedenen Schutzoptionen wählen, die Ihre Selbstbeteiligung im Schadensfall reduzieren. Überlegen Sie sich, wie viel Risiko Sie eingehen wollen und wie viel Sie bereit sind, dafür zu zahlen. Je nach Fahrzeugklasse, Mietdauer und Fahrstrecke kann es sich lohnen, eine höhere Schutzoption zu wählen, um im Falle eines Unfalls weniger zu zahlen.
- Fahrzeug prüfen: Bevor Sie ein Auto bei SIXT Carsharing buchen und öffnen, sollten Sie es gründlich prüfen. Achten Sie darauf, dass das Fahrzeug sauber, gepflegt und vollgetankt ist. Achten Sie auch darauf, dass das Fahrzeug keine Schäden, Mängel oder Defekte aufweist. Wenn Sie etwas bemerken, was Ihnen nicht gefällt oder was Ihnen Sorgen macht, sollten Sie es sofort (per App) an SIXT melden und gegebenenfalls ein anderes Fahrzeug wählen. Sollten Schäden am Fahrzeug vorhanden sein, ist SIXT jedoch in der Beweislast und muss Ihnen nachweisen, dass die Schäden von Ihnen verursacht wurden.
- Fahren Sie das Fahrzeug rücksichtsvoll: Nachdem Sie das KFZ geprüft und geöffnet haben, können Sie losfahren. Achten Sie dabei auf die geltenden Verkehrsregeln und fahren Sie vorsichtig und umsichtig. Vermeiden Sie es, das Fahrzeug zu überlasten, zu beschädigen oder falsch zu betanken. Wenn Sie das Fahrzeug abstellen wollen, stellen Sie sicher, dass Sie es innerhalb des Geschäftsgebiets von SIXT Share tun und dass Sie es ordnungsgemäß verschließen. Wenn Sie den Mietwagen zurückgeben wollen, beenden Sie die Miete über die App.
- Schließen Sie eine Rechtsschutzversicherung ab: Eine Rechtsschutzversicherung ist eine sinnvolle Ergänzung zu Ihrer Haftpflichtversicherung, die Sie im Falle eines Rechtsstreits mit SIXT oder einem anderen Beteiligten unterstützt. Eine Rechtsschutzversicherung übernimmt in der Regel die Kosten für einen Anwalt oder unterstützt Sie bei einem Gerichtsverfahren finanziell. Sie können eine Rechtsschutzversicherung entweder als Einzelpolice oder als Zusatz zu Ihrer Hausrat-, Haftpflicht- oder Kfz-Versicherung abschließen. Achten Sie dabei auf die jeweils inkludierten Leistungen, die Bedingungen und die Selbstbeteiligung der Versicherung.

4. Wie sollte ich reagieren, wenn wirklich ein Unfall mit meinem Mietwagen bei SIXT Share passiert ist?
Wenn Sie einen Unfall mit dem Mietwagen bei SIXT Share haben, sollten Sie folgende Schritte befolgen, um die Situation richtig zu handhaben und Ihre Rechte zu wahren:
- Bei Unfällen, Diebstahl oder Schäden am Fahrzeug muss sofort das SIXT Share-Supportteam telefonisch informiert werden. (+49 89 307 04704),
- Jeder Unfall oder Schaden, unabhängig von der Schuldfrage, muss unverzüglich der Polizei gemeldet und diese hinzugezogen werden. Wenn die Polizei telefonisch nicht erreichbar ist, muss der Schaden an der nächstgelegenen Polizeistation gemeldet werden.
- Der Mieter darf den Unfallort erst verlassen, wenn die polizeiliche Aufnahme abgeschlossen ist und das Fahrzeug an ein Abschleppunternehmen übergeben wurde oder eine entsprechende Anweisung vom Sixt-Supportteam erfolgt ist. Ausnahmen gelten, wenn der Mieter aufgrund von Verletzungen den Unfallort verlassen muss.
- Der Mietvertrag endet erst nach ordnungsgemäßer Rückgabe des Fahrzeugs. Wenn das Fahrzeug aufgrund eines Unfalls nicht mehr fahrbereit ist, endet der Mietvertrag nach Absprache mit Sixt mit der Übergabe an ein Abschleppunternehmen.
- Der Mieter muss Sixt einen schriftlichen Unfallbericht und das polizeiliche Aktenzeichen umgehend weiterleiten. Alle Anweisungen des SIXT-Support Teams müssen befolgt werden. Es ist dem Mieter untersagt, ein Schuldanerkenntnis abzugeben oder Zahlungen jedweder Art zu leisten.
Ausführliche Anweisungen zum Verhalten nach einem Unfall mit einem Fahrzeug von SIXT Share finden sich auch unter Punkt G: Unfälle, Diebstahl, Anzeigepflichten, Versicherung, Obliegenheiten in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
5. Was kann ich tun, falls mir SIXT nachträglich einen Schaden anhängen will?
Es kann vorkommen, dass Ihnen SIXT nachträglich einen Schaden "anhängen will", den Sie nicht verursacht haben oder der bereits vor der Miete vorhanden war. In diesem Fall sollten Sie folgende Schritte unternehmen, um sich zu wehren:
- Widersprechen Sie der Forderung: Wenn Sie eine Forderung von SIXT erhalten, die Sie für unberechtigt halten, sollten Sie dieser schriftlich widersprechen. Spezielle Erklärungen brauchen Sie nicht abzugeben, denn grundsätzlich ist SIXT in der Beweispflicht und muss Ihnen nachweisen, dass Sie den Schaden verursacht haben.
- Holen Sie sich juristische Unterstützung: Wenn Sie sich unsicher sind, wie Sie vorgehen sollen, sollten Sie sich juristische Unterstützung holen. Ein Anwalt für Verkehrsrecht kann Sie beraten, wie Sie Ihre Rechte durchsetzen oder sich gegen Vorwürfe verteidigen können. Ein Anwalt kann auch für Sie mit SIXT verhandeln, wenn das nötig werden sollte. Die Kosten für einen Anwalt können von Ihrer Rechtsschutzversicherung übernommen werden, wenn Sie eine abgeschlossen haben. Ansonten klärt Sie ein Anwalt auch transparent über die Kosten auf.
- Lassen Sie sich nicht einschüchtern: Wenn Sie einen Schaden nicht verursacht haben oder wenn Sie eine Schutzoption gewählt haben, die Ihre Selbstbeteiligung reduziert, sollten Sie sich nicht einschüchtern lassen. SIXT hat das Recht, den Schaden zu prüfen und zu regulieren, aber nicht, Ihnen unberechtigte Forderungen zu stellen. Lassen Sie sich daher nicht von dem Unternehmen unter Druck setzen. Bleiben Sie sachlich und bestehen Sie auf Ihrem Recht. Scheuen Sie sich auch nicht jursitischen Rat einzuholen.
INFO: Drei Trends für die Zukunft von Carsharing:
- Elektromobilität: Elektroautos sind umweltfreundlicher, leiser und günstiger im Betrieb als herkömmliche Autos. Sie sind daher ideal für das Carsharing geeignet, da sie die Emissionen und die Kosten beim gemeinschaftlichen Teilen von Fahrzeugen reduzieren. Viele Carsharing-Anbieter setzen bereits auf Elektroautos oder planen, ihre Flotte zu elektrifizieren. Zum Beispiel hat WeShare in Berlin eine reine Elektroflotte mit über 1.500 Fahrzeugen. Auch SIXT Share bietet Elektroautos an, die mit einem grünen Blitz in der App gekennzeichnet sind.
- Autonomes Fahren: Autonomes Fahren ist die nächste Stufe der Mobilität, die das Carsharing revolutionieren könnte. Autonome Fahrzeuge sind selbstfahrende Autos, die ohne menschliches Eingreifen fahren können. Sie könnten das Carsharing noch flexibler, sicherer und komfortabler machen, da sie die Nutzer abholen und absetzen könnten, ohne dass diese einen Parkplatz suchen oder das Fahrzeug bedienen müssten. Außerdem könnten sie die Auslastung und die Verfügbarkeit der Fahrzeuge optimieren, indem sie sich selbstständig zu den Orten bewegen, wo sie gebraucht werden. Einige Carsharing-Anbieter wie Share Now oder Miles testen bereits autonome Fahrzeuge in Pilotprojekten.
- Plattformökonomie: Dabei handelt es sich um ein Geschäftsmodell, das auf digitalen Plattformen basiert, die Angebot und Nachfrage vermitteln. Plattformen wie Uber, Lyft oder BlaBlaCar bieten alternative Mobilitätslösungen an, die das Carsharing ergänzen oder konkurrenzieren können. Zum Beispiel können Nutzer über diese Plattformen Fahrten mit anderen teilen, Fahrer oder Mitfahrer finden oder private Autos vermieten oder mieten. Auch SIXT hat eine Plattform namens SIXT ONE gestartet, die verschiedene Mobilitätsdienste wie Carsharing, Autovermietung, Taxi oder Fahrradverleih bündelt.
6. Wie kann ich beweisen, dass ich einen SIXT Schaden nicht verursacht habe?
Wichtig: Wenn Sie einen Schaden nicht verursacht haben oder wenn er bereits vor der Miete vorhanden war, muss SIXT beweisen, dass Sie den Schaden verursacht haben. Inwiefern gegebenenfalls ein Gegenbeweis erbracht werden muss, kommt dabei immer auf den jeweiligen Einzelfall an. Um Ihre Unschuld zu belegen oder zumindest Zweifel an der Schuld zu wecken, können Sie verschiedene Möglichkeiten nutzen. Zu den wohl gängigsten Mitteln gehören:
- Fotos: Selbst geknipste Bilder sind ein wichtiges Beweismittel, um den Zustand des Fahrzeugs vor und nach der Miete zu dokumentieren. Machen Sie daher immer Fotos von dem Fahrzeug, bevor Sie es öffnen und losfahren, und nachdem Sie es abstellen und abschließen. Achten Sie darauf, dass die Fotos klar, scharf und aktuell sind. Sie sollten das gesamte Fahrzeug sowie alle Details, die relevant sein könnten, wie zum Beispiel Kratzer, Dellen, Risse oder Flecken, zeigen. Sie sollten auch die Umgebung, die Wetterbedingungen und die Uhrzeit aus den Fotos erkennen können. Bewahren Sie die Fotos auf Ihrem Smartphone oder einem anderen Speichermedium auf und senden Sie diese an SIXT, wenn Sie einen Schaden melden oder einem Schaden widersprechen.
- Quittungen und Belege: Quittungen sind ein weiteres Beweismittel, um den Zeitpunkt und den Ort der Miete zu belegen. Bewahren Sie daher immer die Quittungen auf, die Sie von SIXT erhalten, wenn Sie ein Fahrzeug buchen, öffnen, schließen oder zurückgeben. Die Quittungen sollten die Fahrzeugdaten, die Mietdauer, die gefahrenen Kilometer, die Schutzoption, den Preis und die Zahlungsweise enthalten. Unser Tipp: Heben Sie auch Rechnungen auf, die Sie von anderen Dienstleistern erhalten, die mit dem Fahrzeug in Verbindung stehen, zum Beispiel von Tankstellen oder Parkhäusern. Die Quittungen können Ihnen helfen, nachzuweisen, wann und wo Sie das Fahrzeug genutzt haben und ob Sie es ordnungsgemäß behandelt haben.
- Zeuginnen und Zeugen: Zeugen sind eine weitere Möglichkeit, um Ihre Aussage zu stützen oder zu widerlegen. Wenn Sie einen Unfall haben oder einen Schaden bemerken, sollten Sie daher immer nach Zeugen suchen, die den Vorfall beobachtet oder bestätigt haben. Das können zum Beispiel andere Verkehrsteilnehmer, Passanten, Anwohner oder Mitarbeiter von SIXT sein. Notieren Sie sich die Namen, Adressen und Telefonnummern der Zeugen und bitten Sie sie, eine schriftliche oder mündliche Aussage zu machen. Die Zeugen können Ihnen helfen, die Umstände und die Folgen des Unfalls oder des Schadens zu klären und Ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Besonders gut geeignet sind natürlich Beifahrerinnen und Beifahrer. Sie können zweifelsfrei bezeugen, wenn es keinen Schaden gab.

7. Wie kann mir ein Anwalt für Verkehrsrecht dabei helfen, mich gegen Vorwürfe von SIXT zur Wehr zu setzen?
Ein Anwalt für Verkehrsrecht ist ein juristischer Spezialist, der sich auf das Rechtsgebiet des Verkehrsrechts spezialisiert hat. Das Verkehrsrecht umfasst alle Rechtsfragen, die mit dem Straßenverkehr zu tun haben, wie zum Beispiel Unfälle, Schäden, Bußgelder, Fahrverbote oder Führerscheinentzug. Ein Anwalt für Verkehrsrecht kann Ihnen folgendermaßen dabei helfen, sich zu wehren, wenn Ihnen von SIXT Schäden vorgeworfen werden, für die Sie gar nicht verantwortlich sind:
- Durch Beratung: Eine professionelle juristische Beratung kann Ihnen dabei helfen, Fehler zu vermeiden, die Ihre Situation verschlimmern könnten, und Ihnen Sicherheit und Klarheit bei einem empfehlenswerten Verhalten geben.
- Durch juristische Vertretung: Der beauftragte Fachanwalt kann in Ihrem Namen mit SIXT verhandeln, um eine gütliche Einigung zu erzielen und die Forderungen abzuwehren. Ein Anwalt für Verkehrsrecht kann außerdem dabei behilflich sein, Ihre Interessen zu wahren, Ihre Ansprüche geltend zu machen oder Ihre Verteidigung vorzubringen.
- Durch eine Abwehr der Vorwürfe: Ein Verkehrsrechtsanwalt wird Sie dabei unterstützen, die unrechtmäßig von SIXT erhobenen Vorwürfe abzuwehren, sodass für Sie keine zusätzlichen Kosten entstehen.
8. Mobilrechtler.de - Ihre erste Adresse bei Streitfällen mit SIXT Share
Wenn SIXT Ihnen Schäden im Rahmen von Carsharing anhängen will (obwohl Sie unschuldig sind) und Sie sich anwaltlich beraten und juristisch zur Wehr setzen wollen, sind Sie bei Mobilrechtler - Einfinger Anwaltskanzlei genau an der richtigen Adresse. Wir sind eine kompetente und erfahrene Kanzlei, die sich auf das Verkehrsrecht fokussiert. Unsere große Zahl an positiven Bewertungen bestärkt uns in unserem täglichen Tun. Als begeisterte Fans von allem, was Räder hat, haben wir ein besonderes Interesse an den Themen E-Mobilität und Oldtimer und geben bei jedem Fall unser Bestes, um unsere Mandantinnen und Mandanten zu unterstützen. Sie haben Probleme, weil Ihnen von SIXT zu Unrecht ein Schaden mit einem Mietwagen vorgeworfen wird? Wir kennen uns hervorragend mit dieser Art von Fällen aus und konnten bereits vielen Menschen dabei helfen, sich erfolgreich gegen SIXT Share zur Wehr zu setzen und die Ansprüche abzuwehren. Wir helfen Ihnen bei einer anwaltlichen Beratung garantiert mit Fachwissen und der nötigen Hartnäckigkeit weiter. Kontaktieren Sie uns am besten noch heute per E-Mail, Telefon oder über Kontaktformular, damit wir Sie fallbezogen und individuell beraten und Ihnen weiterhelfen können.
Wollen Sie mehr über das Thema Verkehrsrecht erfahren? Dann schauen Sie sich diese informativen Ratgeber an!
- Anhörung im Bußgeldverfahren: 7 Verhaltenstipps vom Anwalt
- Vorwurf der Fahrerflucht? Was Sie dazu wissen sollten - Hinweise vom Anwalt
- Fahrverbot umgehen - 4 Tipps vom Anwalt für Verkehrsrecht
Bildquelle:
www.unsplash.com
www.unlimphotos.com
Unfall im Ausland: Was tun? | Zentralruf der Autoversicherer
Wie kann ich die Dauer der Schadensregulierung nach einem KFZ-Unfall KFZ verkürzen? Was ist der korrekte Ablauf bei der Versicherung? Jetzt mehr erfahren!

Wie lange dauert eine Schadensregulierung nach einem KFZ-Unfall?
Ein KFZ-Unfall ist immer eine unangenehme und stressige Situation. Neben den gesundheitlichen und emotionalen Folgen müssen Sie sich auch um die finanziellen und rechtlichen Aspekte kümmern. Dazu gehört die Schadensregulierung, also die Abwicklung des Schadens mit der Versicherung des Unfallverursachers oder Ihrer eigenen Versicherung. Doch wie lange dauert eine Schadensregulierung nach einem KFZ-Unfall? Welche Faktoren beeinflussen die Dauer? Und was können Sie tun, um den Prozess zu beschleunigen? In diesem Ratgeber erfahren Sie alles Wichtige, was Sie über die Schadensregulierung nach einem Verkehrsunfall mit einem Auto wissen sollten.
Übersicht:
- Schadensregulierung nach einem Unfall - was ist das überhaupt?
- Wo ist die Schadensregulierung rechtlich geregelt?
- Wer kann eine Schadensregulierung in Anspruch nehmen?
- Wie ist der Ablauf einer Schadensabwicklung?
- Wer bestimmt die Höhe des Schadens?
- Wer muss einen Unfall der KFZ-Versicherung melden?
- Wie lange dauert es, bis eine Versicherung den Schaden reguliert?
- Wie lässt sich eine Schadensregulierung beschleunigen?
- Welche Probleme können im Rahmen einer Schadensregulierung auftreten?
- Was sollte ich als Geschädigter nach einem Unfall unbedingt tun?
- FAQ
1. Schadensregulierung nach einem Unfall - was ist das überhaupt?
Die Schadensregulierung ist der Vorgang, bei dem die Versicherung den Schaden, der durch einen KFZ-Unfall entstanden ist, bewertet, ggf. selbst begutachtet und bei Verschulden des Versicherungsnehmers bezahlt. Dabei kann es sich um einen Sachschaden, also einen Schaden an Ihrem Fahrzeug oder an anderen Gegenständen, oder um einen Personenschaden, also einen Schaden an Ihrer Gesundheit oder an der Gesundheit anderer Beteiligter, handeln. Die Schadensregulierung soll dafür sorgen, dass Sie als Geschädigter finanziell so gestellt werden, wie Sie ohne den Unfall gestanden hätten. Das bedeutet, dass Sie einen Anspruch auf Ersatz der Reparaturkosten (bei Totalschäden des Wertes für den sog. Beschaffungsaufwandes), der Mietwagenkosten, der Heilbehandlungskosten, des Schmerzensgeldes, des Verdienstausfalls und anderer Schadenspositionen haben.
2. Wo ist die Schadensregulierung rechtlich geregelt?
Die Schadensregulierung ist in Deutschland vor allem im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und im Straßenverkehrsgesetz (StVG) geregelt. Das BGB enthält die allgemeinen Regeln für die Haftung bei Schäden, die durch unerlaubte Handlungen, wie z.B. eine Verletzung der Verkehrsregeln, entstehen. Das StVG enthält die speziellen Regeln für die Haftung bei Schäden, die durch den Betrieb eines Kraftfahrzeugs entstehen. Das StVG sieht eine verschuldensunabhängige Haftung des Halters und des Fahrers des KFZ vor, die nur in wenigen Ausnahmefällen ausgeschlossen oder gemindert werden kann. Das bedeutet, dass Sie als Geschädigter in der Regel einen Anspruch auf Schadensersatz gegen den Halter und den Fahrer des unfallverursachenden KFZ haben, unabhängig davon, ob diese den Unfall vorsätzlich oder fahrlässig verursacht haben. Zudem regelt das Versicherungsvertragsgesetz (§ 115 VVG), dass Sie Ihren Anspruch auf Schadensersatz auch gegen den Versicherer geltend machen können.
INFO: Deshalb sollten Sie juristische Hilfe in Anspruch nehmen
Wenn Sie in einen Verkehrsunfall mit dem KFZ verwickelt wurden, sollten Sie sich juristische Unterstützung von einem Anwalt für Verkehrsrecht holen, um Ihre Ansprüche auf Schadensersatz zu sichern und die Schadensregulierung zu erleichtern.
Denn eine Schadensregulierung ist nicht immer ein einfacher und reibungsloser Prozess. Es kann zu verschiedenen Problemen kommen, die den Ablauf der Regulierung verzögern oder im schlimmsten Fall sogar gänzlich verhindern können. Zum Beispiel kann die Schuldfrage unklar sein, die Höhe des Schadens umstritten oder die Versicherung nicht oder zu spät zahlen.
In diesen Fällen kann Ihnen ein Anwalt für Verkehrsrecht dabei helfen, Ihre Unschuld zu beweisen, Ihre Ansprüche zu belegen, Ihre Forderungen zu verhandeln, die gegnerische Versicherung unter Druck zu setzen oder eine Klage einzureichen. Außerdem können Sie die Kosten für den Anwalt vom Versicherer des Unfallverursachers erstattet bekommen, wenn Sie im Recht sind.

3. Wer kann eine Schadensregulierung in Anspruch nehmen?
Eine Schadensregulierung können Sie als Geschädigter in Anspruch nehmen, wenn Sie durch einen KFZ-Unfall einen Schaden erlitten haben, der von einem anderen Verkehrsteilnehmer verursacht wurde. In diesem Fall können Sie Ihre Ansprüche direkt gegen die KFZ-Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers geltend machen. Die KFZ-Haftpflichtversicherung ist eine Pflichtversicherung, die jeder Halter eines KFZ abschließen muss, um die Schäden zu decken, die er mit seinem Fahrzeug anderen zufügt. Die Haftpflichtversicherung ist verpflichtet, Ihre berechtigten Ansprüche zu prüfen und zu erfüllen.
Eine Schadensregulierung können Sie auch in Anspruch nehmen, wenn Sie durch einen Autounfall einen Schaden erlitten haben, der von Ihnen selbst oder von einem unbekannten oder nicht versicherten Verkehrsteilnehmer verursacht wurde. In diesem Fall können Sie Ihre Ansprüche gegen Ihre eigene KFZ-Kaskoversicherung geltend machen, sofern Sie eine solche abgeschlossen haben. Die KFZ-Kaskoversicherung ist eine freiwillige Versicherung, die Sie als Halter eines KFZ abschließen können, um die Schäden zu decken, die an Ihrem eigenen Fahrzeug entstehen. Die KFZ-Kaskoversicherung ist verpflichtet, Ihre berechtigten Ansprüche zu prüfen und zu erfüllen, allerdings unter Berücksichtigung der vertraglichen Vereinbarungen, wie z.B. der Selbstbeteiligung oder der Schadenfreiheitsklasse.
4. Wie ist der Ablauf einer Schadensabwicklung?
Der Ablauf einer Schadensabwicklung hängt davon ab, ob Sie einen Sachschaden oder einen Personenschaden geltend machen wollen. Im Folgenden wird der typische Ablauf einer Schadensabwicklung bei einem Sachschaden beschrieben:
- Polizei in Kenntnis setzen: Nach einem Unfall sollten Sie zunächst die Polizei verständigen, die die Geschehnisse protokolliert und einen Unfallbericht erstellt. Außerdem sollten Sie die Personalien und die Versicherungsdaten des Unfallgegners aufnehmen und Fotos vom Unfallort und den Fahrzeugen machen. Wenn möglich, sollten Sie auch Zeugen befragen und deren Kontaktdaten notieren.
- Schadensmeldung bei der eigenen Versicherung: Als nächstes sollten Sie den Schaden Ihrer eigenen Versicherung melden, egal ob Sie den Unfall verursacht haben oder nicht. Dieser Vorgang ist wichtig, um Ihre vertraglichen Pflichten zu erfüllen und um eventuelle Ansprüche gegen Ihre Kaskoversicherung zu sichern. Sie sollten Ihrer Versicherung alle relevanten Informationen und Unterlagen zum Unfall zur Verfügung stellen, wie z.B. das Polizeiprotokoll, die Fotos, die Zeugenaussagen, die Rechnungen etc.
- Schadensmeldung bei der gegnerischen Versicherung: Wenn Sie den Unfall nicht verursacht haben, sollten Sie auch den Schaden der Versicherung des Unfallgegners melden und Ihre Ansprüche auf Schadensersatz anmelden. Sie sollten der gegnerischen Versicherung ebenfalls alle relevanten Informationen und Unterlagen zum Unfall zur Verfügung stellen.
- Begutachtung des entstandenen Schadens: Parallel dazu sollten Sie einen Kostenvoranschlag für die Reparatur Ihres Fahrzeugs einholen oder einen Sachverständigen beauftragen, der den Schaden begutachtet und den Wiederbeschaffungswert Ihres Fahrzeugs ermittelt. Sie können unter Umständen auch einen Mietwagen nehmen, wenn Ihr Fahrzeug nicht mehr fahrbereit ist, oder eine Nutzungsausfallentschädigung verlangen, wenn Sie beruflich auf Ihr Fahrzeug angewiesen sind. Es ist dabei jedoch zu beachten, dass die Kostenerstattung sich nach der Haftungsquote des Unfalls richtet.
- Angebot zur Schadensregulierung prüfen: Die Versicherung des Unfallgegners wird schlussendlich Ihre erhobenen Ansprüche prüfen und Ihnen ein Angebot zur Schadensregulierung unterbreiten oder ihre eigene Rechtsauffassung darlegen. Wenn Sie das Angebot anzweifeln, können Sie mit der Versicherung verhandeln oder einen Anwalt einschalten, der Ihre Ansprüche durchsetzt. Wenn Sie sich mit der Versicherung nicht einigen können, können Sie auch vor Gericht gehen, um Ihre Ansprüche gerichtlich feststellen zu lassen. Sie können jedoch auch von Anfang an einen Rechtsanwalt beauftragen. Sofern der Unfallgegner schuld ist, werden die Kosten von der gegnerischen Versicherung übernommen.
5. Wer bestimmt die Höhe des Schadens?
Die Höhe des Schadens ist entscheidend für die Schadensregulierung. Denn davon hängt ab, wie viel Geld Sie von der Versicherung erhalten. Doch wer bestimmt eigentlich, wie hoch der Schaden ist? Das hängt auch davon ab, ob Sie sich auf eine konkrete oder eine fiktive Abrechnung einigen.
- Bei einer konkreten Abrechnung lassen Sie Ihr Fahrzeug in einer Werkstatt reparieren und reichen die Rechnung bei der Versicherung ein. Die Versicherung übernimmt dann die Kosten für die Reparatur, sofern sie angemessen sind. Ob und in welcher Höhe die Reparaturkosten berechtigt sind, wird üblicherweise durch das zuvor eingeholte Sachverständigengutachten festgestellt.
- Bei einer fiktiven Abrechnung verzichten Sie auf eine Reparatur oder führen diese in Eigenregie durch und lassen den Schaden nur von einem Sachverständigen schätzen. Die Versicherung zahlt Ihnen dann den geschätzten Betrag aus, abzüglich der Mehrwertsteuer. Sie können dann selbst entscheiden, ob Sie das Geld für eine Reparatur verwenden oder nicht.
Die Wahl zwischen einer konkreten oder einer fiktiven Abrechnung liegt bei Ihnen als Geschädigtem. Sie sollten sich aber gut überlegen, welche Variante für Sie günstiger ist. Denn eine fiktive Abrechnung kann unter Umständen zu einem geringeren Schadensersatz führen, wenn der KFZ Gutachter den Schaden niedriger einschätzt als die Werkstatt. Es ist aber auch möglich, nach einer fiktiven Abrechnung auf die konkrete zu wechseln. Außerdem kann eine fiktive Abrechnung den Wiederverkaufswert Ihres Fahrzeugs mindern, wenn Sie den Schaden nicht beheben lassen. Hierbei ist zudem dringend zu beachten, dass die Regulierung späterer anderer Schäden ausgeschlossen sein kann, sofern das Fahrzeug nicht repariert wird.
INFO: Wie lange dauert die Schadensregulierung bei einem Verkehrsunfall mit KFZ-Beteiligung in der Regel?
Bei der Dauer der Schadensregulierung kommt es auf den Einzelfall an. Denn jeder Schaden hat seine Eigenarten. Eine gesetzliche Frist gibt es dafür nicht, aber die Versicherungen müssen sich an die Grundsätze der Schadenminderungspflicht und der Schadensabwicklung in angemessener Zeit halten. Das bedeutet, dass sie den Schaden so gering wie möglich halten und so schnell wie möglich bearbeiten müssen.
Als Faustregel gilt zwar, dass eine Schadensregulierung innerhalb von 4 bis 6 Wochen abgeschlossen sein sollte. Wenn es länger dauert, können Sie die Versicherung zur Beschleunigung auffordern oder sogar Verzugszinsen verlangen.
Jedoch ist auch zu beachten, dass viele Versicherungen - insbesondere in Zeiten von Krankheitswellen - überlastet sind und auch Dritte auf die Regulierung Einfluss nehmen.
So kann es zum Beispiel sein, dass in die Unfallakte Einsicht genommen werden muss, um Beweise darzulegen. Diese Einsicht erhält man meist erst nach Abschluss der Ermittlungen, auf deren Dauer man keinen Einfluss hat. Daher beträgt die Dauer der Regulierung aktuell (Stand: Januar 2024) im Durchschnitt gut 3 Monate.
6. Wer muss einen Unfall der KFZ-Versicherung melden?
Wenn Sie in einen Unfall verwickelt sind, müssen Sie einige Formalitäten erledigen. Dazu gehört auch, den Unfall der KFZ-Versicherung zu melden. Doch wer muss das tun? Und wie schnell muss das geschehen?
- Als Unfallverursacher müssen Sie den Unfall Ihrer eigenen KFZ-Haftpflichtversicherung melden. Das sollten Sie möglichst schnell tun, am besten innerhalb einer Woche. Ihre Versicherung muss den Schaden des Geschädigten übernehmen und braucht dafür alle relevanten Informationen.
- Als Geschädigter müssen Sie den Unfall zunäcsht der KFZ-Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers melden. Das sollten Sie ebenfalls möglichst schnell tun, um Ihre Ansprüche geltend zu machen. Sie können dazu das Unfallprotokoll verwenden, das Sie am Unfallort ausgefüllt haben. Wenn Sie den Unfall nicht oder zu spät melden, kann die Versicherung des Unfallverursachers Ihre Ansprüche ablehnen oder kürzen. Ihrer eigenen Versicherung gegenüber müssen Sie den Schaden ebenso melden. Dies ergibt sich aus einer vertraglichen Obliegenheit.
Um den Unfall der Versicherung zu melden, können Sie einen Anruf, eine E-Mail oder einen Brief schreiben. Wichtig ist, dass Sie alle relevanten Daten angeben, wie zum Beispiel:
- Ihre persönlichen Daten und die des Unfallgegners bzw. der Unfallgegnerin
- Die Kennzeichen und die Versicherungsnummern der beteiligten Fahrzeuge
- Den Ort, das Datum und die Uhrzeit des Unfalls
- Den Hergang und die Ursache des Unfalls
- Die Art und den Umfang des Schadens
- Die Namen und die Kontaktdaten von möglichen Zeuginnen oder Zeugen
- Die Namen und die Dienststellen von eventuell eingeschalteten Polizeibeamtinnen oder -beamten
- Die Beweise für den Unfall, wie zum Beispiel Fotos, Skizzen oder Gutachten

7. Wie lange dauert es, bis eine Versicherung den Schaden reguliert?
Nachdem Sie den Unfall der Versicherung gemeldet haben, bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als darauf zu warten, dass die Versicherung die Schadensregulierung einleitet. Das bedeutet, dass die Versicherung den Schaden prüft und Ihnen den Schadensersatz auszahlt. Doch wie lange dauert das? Und gibt es für die maximale Dauer eine gesetzliche Frist?
Leider gibt es keine eindeutige Antwort auf diese Fragen. Denn die Dauer der Schadensregulierung hängt von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel:
- Der Komplexität des Unfalls
- Der Höhe des Schadens
- Der Anzahl der beteiligten Parteien
- Der Verfügbarkeit von Beweisen
- Der Kooperationsbereitschaft der Versicherungen
- Der Einhaltung der Formalitäten
8. Wie lässt sich eine Schadensregulierung beschleunigen?
Wenn Sie nach einem Unfall auf Ihren Schadensersatz warten, wollen Sie natürlich, dass die Schadensregulierung so schnell wie möglich abgeschlossen wird. Denn vermutlich benötigen Sie das Geld, um Ihr Fahrzeug zu reparieren oder zu ersetzen, oder um andere Kosten zu decken. Doch wie können Sie die Schadensregulierung beschleunigen? Hier sind einige Tipps, die Ihnen dabei helfen können, den Ablauf der Schadensregulierung voranzutreiben:
- Melden Sie den Unfall so schnell wie möglich den Versicherungen. Je eher die Versicherung von dem Unfall erfährt, desto eher kann sie den Schaden prüfen und bearbeiten.
- Sammeln Sie alle Beweise für den Unfall. Je mehr Beweise Sie haben, desto einfacher können Sie Ihre Ansprüche belegen und die Schuldfrage klären. Dazu gehören zum Beispiel Fotos, Skizzen, Zeugenaussagen, Polizeiberichte oder Gutachten.
- Beauftragen Sie einen unabhängigen Unfallsachverständigen. Wenn Sie den Schaden an Ihrem Fahrzeug von einem unabhängigen Sachverständigen schätzen lassen, können Sie die Höhe des Schadensersatzes besser begründen und verhandeln. Außerdem können Sie so vermeiden, dass die Versicherung den Schaden zu niedrig einschätzt oder anzweifelt. In bestimmten Fällen kann aber auch ein Kostenvoranschlag genügen. Zum Beispiel wird bei Bagatellschäden ein Gutachten nicht erstattet. Bei streitigen Umständen sollten Sie vorab rechtlichen Rat einholen, da die Kosten des Sachverständigen sich nach der Haftungsquote richten.
- Kommunizieren Sie klar, aber freundlich mit den Versicherungen. Wenn Sie mit der Versicherung in Kontakt treten, seien Sie höflich, aber bestimmt. Geben Sie alle notwendigen Informationen an und beantworten Sie alle Fragen. Setzen Sie klare Fristen und Termine und halten Sie sich selbst an alle getroffenen Vereinbarungen. Dokumentieren Sie alle Schritte der Schadensregulierung schriftlich.
- Holen Sie sich juristische Unterstützung. Wenn Sie sich bei der Schadensregulierung unsicher sind oder Probleme haben, können Sie sich an einen Anwalt für Verkehrsrecht wenden. Dieser kann Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche helfen, die Versicherung unter Druck setzen oder eine Klage einreichen, falls sich die Regulierung über das übliche Maß hinauszieht.
INFO: Welche Unfälle liegen einer Schadensregulierung in Deutschland am häufigsten zugrunde?
Laut der Statistik des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) gab es im Jahr 2022 rund 2,4 Millionen KFZ-Haftpflichtschäden in Deutschland, die eine Schadensregulierung erforderten. Die häufigsten Unfallursachen waren dabei:
- Auffahrunfälle. Das waren rund 28 Prozent aller KFZ-Haftpflichtschäden. Dabei fuhr ein Fahrzeug auf ein anderes Fahrzeug auf, das vor ihm stand oder langsamer fuhr. Die durchschnittliche Schadenhöhe betrug rund 2.600 Euro.
- Wildunfälle. Rund 14 Prozent aller KFZ-Haftpflichtschäden. Dabei kollidierte ein KFZ mit einem Wildtier, wie zum Beispiel einem Reh, einem Hirsch oder einem Wildschwein. Die durchschnittliche Schadenhöhe betrug in diesen Fällen ca. 3.000 Euro.
- Parkunfälle. Mit ca. 13 Prozent aller KFZ-Haftpflichtschäden. Dabei beschädigte ein Auto ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken oder beim Vorbeifahren. Durchschnittliche Schadenhöhe: Rund 1.500 Euro.
9. Welche Probleme können im Rahmen einer Schadensregulierung auftreten?
Eine Schadensregulierung ist nicht immer ein einfacher und reibungsloser Prozess. Es kann zu verschiedenen Problemen kommen, die die Schadensregulierung verzögern oder verhindern können. Zu den häufigsten Problemen gehören:
- Die Schuldfrage ist nicht klar. Wenn die Versicherung des Unfallverursachers die Schuld bestreitet oder eine Mitschuld des Geschädigten behauptet, kann die Schadensregulierung kompliziert werden. In diesem Fall müssen Sie Ihre Unschuld beweisen oder eine Teilschuld akzeptieren, was zu einem geringeren Schadensersatz führen kann.
- Die Höhe des Schadens ist umstritten. Wenn die Versicherung des Unfallverursachers den Schaden zu niedrig einschätzt oder anzweifelt, kann die Schadensregulierung ins Stocken geraten. Tritt dieser Fall ein, müssen Sie den Schaden nachweisen oder nachverhandeln, was zu einem längeren Verfahren führen kann.
- Die Versicherung zahlt nicht oder zu spät. Wenn die Versicherung des Unfallverursachers den Schaden nicht oder nur teilweise anerkennt oder auszahlt, kann die Schadensregulierung gänzlich scheitern. In diesen Fällen müssen Sie die Versicherung zur Zahlung auffordern oder gerichtlich vorgehen, was zu einem aufwendigen und kostspieligen Prozess führen kann.
Selbst, wenn eines dieser Probleme bei der Schadensregulierung auftritt, sollten Sie sich keineswegs entmutigen lassen. Als Geschädigter haben Sie zweifellos das Recht, Ihren Schaden ersetzt zu bekommen.

10. Was sollte ich als Geschädigter nach einem Unfall unbedingt tun?
Wenn Sie in einen Unfall verwickelt sind, sollten Sie einige wichtige Schritte unternehmen, um Ihre Ansprüche auf Schadensersatz zu sichern und die Schadensregulierung zu erleichtern. Hier sind einige Tipps, was Sie als Geschädigter nach einem Unfall unbedingt tun sollten:
- Ruhig und besonnen bleiben: Bleiben Sie (so gut es geht) ruhig und sachlich und überprüfen Sie, ob Sie oder andere Personen verletzt sind. Wenn ja, rufen Sie sofort den Rettungsdienst an. Atmen Sie tief durch und versuchen Sie, nicht in allzu große Aufregung oder sogar Panik zu geraten.
- Unfallstelle absichern: Sichern Sie die Unfallstelle ab und stellen Sie die Warnblinkanlage an. Wenn möglich, stellen Sie Ihr Fahrzeug an den Rand oder auf einen Parkplatz. Ziehen Sie eine Warnweste an und stellen Sie ein Warndreieck auf.
- Polizei rufen: Informieren Sie die Polizei über den Unfall. Das ist vor allem dann wichtig, wenn es zu Personenschäden, hohen Sachschäden, Fahrerflucht oder Streitigkeiten gekommen ist.
- Daten austauschen: Tauschen Sie mit dem Unfallgegner die persönlichen Daten und die Versicherungsdaten aus. Verwenden Sie dazu am besten das europäische Unfallprotokoll, das Sie in Ihrem Handschuhfach haben sollten. Unterschreiben Sie aber nichts, was Sie nicht verstehen oder was Ihre Schuld einräumt.
- Beweise sichern: Sammeln Sie alle Beweise für den Unfall. Machen Sie Fotos von der Unfallstelle, den Fahrzeugen, den Schäden und den Verletzungen. Zeichnen Sie eine Skizze vom Unfallhergang. Notieren Sie sich die Namen und die Kontaktdaten von möglichen Zeugen. Bewahren Sie alle Belege und Rechnungen auf, die mit dem Unfall zusammenhängen.
- Versicherungen informieren: Melden Sie den Unfall so schnell wie möglich der Ihrer eigenen Versicherung, aber vor allem der Versicherung des Unfallverursachers. Geben Sie alle notwendigen Informationen an und fordern Sie eine Schadensnummer an. Bewahren Sie alle Schriftstücke und Korrespondenzen auf, die Sie von der Versicherung erhalten.
- Schaden schätzen lassen: Beauftragen Sie einen unabhängigen KFZ Gutachter, um den Schaden an Ihrem Fahrzeug zu schätzen. Lassen Sie sich nicht von der Versicherung des Unfallverursachers einen Sachverständigen aufdrängen, der möglicherweise befangen ist. In einigen Fällen sollte man aber auf einen Kostenvoranschlag zurückgreifen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn lediglich ein Bagatellschaden vorliegt.
- Für Abrechnungsmethode entscheiden: Entscheiden Sie sich für eine konkrete oder eine fiktive Abrechnung. Lassen Sie sich von der Versicherung des Unfallverursachers nicht zu einer bestimmten Abrechnungsart drängen, die für Sie nachteilig sein könnte.
- Juristische Unterstützung in Anspruch nehmen: Holen Sie sich juristische Unterstützung, wenn Sie sich bei der Schadensregulierung unsicher sind oder Probleme haben. Ein Anwalt für Verkehrsrecht kann Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche helfen, damit Sie eine möglichst schnelle Schadensregulierung erzielen können. Sofern Sie keine Schuld haben, übernimmt auch die gegnerische Versicherung die Kosten.
FAQ
Hier sind einige häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema Schadensregulierung nach Unfall:
- Mir ist jemand reingefahren, muss ich das meiner Versicherung melden?
Wenn Sie in einen Unfall verwickelt sind, bei dem Ihnen jemand reingefahren ist, müssen Sie dies sowohl der eigenen als auch der gegnerischen Versicherung melden. Als Geschädigter haben Sie einen Anspruch auf Schadensersatz von der Versicherung des Unfallverursachers. Sie müssen aber den Unfall der Versicherung des Unfallverursachers auch rechtzeitig melden, um Ihre Ansprüche geltend zu machen. Wenn Sie den Unfall nicht oder zu spät melden, kann die Versicherung des Unfallverursachers Ihre Ansprüche ablehnen oder kürzen. - Wird eine Schadensregulierung immer über die KFZ-Haftpflichtversicherung abgewickelt?
Eine Schadensregulierung wird in der Regel über die KFZ-Haftpflichtversicherung abgewickelt, wenn es sich um einen Unfall mit einem anderen Fahrzeug handelt. Die KFZ-Haftpflichtversicherung ist eine gesetzliche Pflichtversicherung, die jeder Fahrzeughalter abschließen muss. Sie deckt die Schäden ab, die Sie mit Ihrem Fahrzeug an anderen Personen oder Sachen verursachen. Wenn Sie in einen Unfall verwickelt sind, bei dem Sie der Unfallverursacher sind, muss Ihre KFZ-Haftpflichtversicherung den Schaden des Geschädigten übernehmen. Wenn Sie in einen Unfall verwickelt sind, bei dem Sie der Geschädigte sind, haben Sie Anspruch auf Schadensersatz von der KFZ-Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers. - Welche weiteren Möglichkeiten der Schadensregulierung existieren, z.B. Abrechnung auf Reparaturkostenbasis?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Schadensregulierung, die je nach Art und Umfang des Schadens in Frage kommen können. Dazu gehören zum Beispiel:
Die Abrechnung auf Reparaturkostenbasis. Das bedeutet, dass Sie Ihr Fahrzeug in einer Werkstatt reparieren lassen und die Rechnung bei der Versicherung des Unfallverursachers einreichen. Die Versicherung übernimmt dann die Kosten für die Reparatur, sofern sie angemessen sind. Welche Kosten angemessen sind, sollte man in einem Gutachten vorab feststellen lassen.
Die Abrechnung auf Totalschadenbasis. Das bedeutet, dass Ihr Fahrzeug so stark beschädigt ist, dass eine Reparatur unwirtschaftlich oder unmöglich ist. Die Versicherung zahlt Ihnen dann den Wiederbeschaffungswert Ihres Fahrzeugs aus, abzüglich des Restwerts. Der Wiederbeschaffungswert ist der Betrag, den Sie aufwenden müssten, um ein gleichwertiges Fahrzeug zu kaufen. Der Restwert ist der Betrag, den Sie für Ihr beschädigtes Fahrzeug noch erzielen könnten, zum Beispiel durch einen Verkauf an einen Schrotthändler.
Die Abrechnung auf Schmerzensgeldbasis. Das bedeutet, dass Sie bei einem Unfall verletzt wurden und dadurch körperliche oder seelische Schmerzen erlitten haben. Die Versicherung zahlt Ihnen dann eine angemessene Entschädigung für Ihre Schmerzen aus, die je nach Schwere und Dauer der Verletzung variieren kann. Die Höhe des Schmerzensgeldes richtet sich nach der Rechtsprechung und daraus resultierenden Schmerzensgeldtabellen, die Sie im Internet finden können. - Welche Versicherungsleistungen kann eine Schadensregulierung neben dem Sachschadenersatz noch enthalten?
Eine Schadensregulierung kann neben dem Sachschadenersatz noch weitere Versicherungsleistungen enthalten, die je nach Art und Umfang des Schadens anfallen können. Dazu gehören zum Beispiel:
Die Nutzungsausfallentschädigung. Das bedeutet, dass Sie für die Zeit, in der Sie Ihr Fahrzeug nicht nutzen können, eine Entschädigung von der Versicherung erhalten. Die Höhe der Nutzungsausfallentschädigung richtet sich nach der Dauer der Reparatur oder der Wiederbeschaffung und nach der Fahrzeugklasse, zu der Ihr Fahrzeug gehört. Sie können auch einen Mietwagen nehmen, anstatt die Nutzungsausfallentschädigung zu beanspruchen, aber die Kosten dafür müssen angemessen sein und von der Versicherung genehmigt werden. Einem Gutachten können Sie auch Ausführungen zur Dauer des Nutzungsausfalls entnehmen.
Die Umsatzsteuer. Das bedeutet, dass Sie die Umsatzsteuer, die auf die Reparaturkosten oder den Wiederbeschaffungswert Ihres Fahrzeugs anfällt, von der Versicherung erstattet bekommen. Das gilt aber nur, wenn Sie die Reparaturkosten oder den Wiederbeschaffungswert auch tatsächlich bezahlen. Wenn Sie eine fiktive Abrechnung wählen oder die Reparaturkosten oder den Wiederbeschaffungswert nicht bezahlen, erhalten Sie die Umsatzsteuer nicht.
Die merkantile Wertminderung. Das bedeutet, dass Sie einen Ausgleich für den Wertverlust Ihres Fahrzeugs erhalten, der durch den Unfall entstanden ist. Denn auch wenn Ihr Fahrzeug repariert wird, kann es sein, dass es einen geringeren Wiederverkaufswert hat, weil es als Unfallwagen gilt. Die Höhe der merkantilen Wertminderung richtet sich nach dem Alter, dem Zustand und dem Kilometerstand Ihres Fahrzeugs sowie nach der Schwere des Schadens. Die Wertminderung kann in einem Gutachten festgestellt werden. - Wer hilft mir bei der Schadensregulierung?
Wenn Sie bei der Schadensregulierung Hilfe brauchen, können Sie sich an verschiedene Stellen wenden, die Ihnen Unterstützung anbieten können. Dazu gehören zum Beispiel:
Die Verbraucherzentrale. Das ist eine unabhängige Organisation, die Ihnen Informationen und Beratung zu verschiedenen Themen rund um den Verbraucherschutz bietet. Sie können sich an die Verbraucherzentrale wenden, wenn Sie Fragen zur Schadensregulierung haben oder wenn Sie sich von der Versicherung unfair behandelt fühlen. Die Verbraucherzentrale kann Ihnen auch bei der Beschwerde oder der Klage gegen die Versicherung helfen.
Ein Anwalt für Verkehrsrecht. Das ist ein Rechtsanwalt, der sich auf das Verkehrsrecht spezialisiert hat und Ihnen bei der Schadensregulierung professionell zur Seite steht. Sie können sich an einen Anwalt für Verkehrsrecht wie Alexander Einfinger wenden, wenn Sie sich bei der Schadensregulierung unsicher sind oder Probleme haben. Ein entsprechend ausgebildeter Anwalt kann Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche helfen, bei der Versicherung nachfragen, diese unter Druck setzen oder eine Klage vor Gericht einreichen. Ein Vorteil: Sie können die Kosten für den Anwalt von der Versicherung des Unfallverursachers erstattet bekommen, wenn Sie im Recht sind.
Wie kann mir Mobilrechtler - Einfinger Anwaltskanzlei bei der Schadensregulierung helfen?
Wenn Sie einen Anwalt für Verkehrsrecht suchen, der Ihnen bei der Schadensregulierung nach einem KFZ-Unfall hilft, sind Sie bei Mobilrechtler - Einfinger Anwaltskanzlei an der richtigen Adresse. Wir sind erfahrene Kanzlei, die sich auf das Verkehrsrecht spezialisiert hat. Als leidenschaftliche Freunde von Fortbewegungsmitteln interessieren wir uns insbesondere für die Themen E-Mobilität und Oldtimer und versuchen bei jedem Fall, unsere Mandanten bestmöglich zu unterstützen.
Egal, ob ein Sachschaden oder ein Personenschaden vorliegt und ob Sie eine konkrete oder eine fiktive Abrechnung wünschen, wir helfen Ihnen bei einer Schadensregulierung im automobilen Umfeld garantiert mit Sachverstand und der nötigen Beharrlichkeit weiter. Kontaktieren Sie uns am besten heute noch per E-Mail, Telefon oder über Kontaktformular, damit wir Ihnen schnellstmöglich zu Ihrem Recht verhelfen können.
Kennen Sie schon diese informativen Ratgeber rund um das Thema Verkehrsrecht? Lesen Sie doch mal rein!
Unfall im Ausland: Was tun? | Zentralruf der Autoversicherer
Macht ein Einspruch gegen den Bußgeldbescheid Sinn? Wie gehe ich am besten vor? Tipps von Mobilrechtler Einfinger Anwaltskanzlei | Jetzt informieren!

Wann lohnt sich der Einspruch gegen einen Bußgeldbescheid?
Wenn Sie einen Bußgeldbescheid erhalten haben, kann es sich lohnen, diesen genau zu prüfen und gegebenenfalls Einspruch einzulegen. Denn nicht immer sind die Bescheide fehlerfrei oder gerechtfertigt. In diesem Ratgeber erfahren Sie unter anderem, was ein Bußgeldbescheid ist, welche Gründe für Bußgeldbescheide im Straßenverkehr häufig sind, wie Sie auf einen Bußgeldbescheid reagieren sollten und wie die Verjährung bei diesem Thema geregelt ist. Außerdem finden Sie weitere wichtige Informationen rund um das Thema Ordnungswidrigkeiten und die Empfehlung für einen kompetenten Anwalt für Verkehrsrecht. Wir wünschen Ihnen viele wertvolle Erkenntnisse beim Lesen.
Übersicht:
1. Was ist ein Bußgeldbescheid?
2. Was sind die häufigsten Gründe für Bußgeldbescheide?
3. Wie sollte ich reagieren, wenn ich einen Bußgeldbescheid erhalte?
4. Ablauf des gerichtlichen Verfahrens
5. Wann sollte ich Einspruch gegen den Bußgeldbescheid einlegen?
6. Wie ist die Verjährung beim Bußgeldbescheid geregelt?
7. Weitere wichtige Informationen rund um das Thema Ordnungswidrigkeiten
8. Warum Sie sich juristische Unterstützung holen sollten
1. Was ist ein Bußgeldbescheid?
Ein Bußgeldbescheid ist ein behördlicher Bescheid, der eine Geldbuße und gegebenenfalls weitere Nebenfolgen wie Punkte in Flensburg oder ein Fahrverbot verhängt. Ein Bußgeldbescheid wird erlassen, wenn Ihnen eine Ordnungswidrigkeit im Straßenverkehr vorgeworfen wird. Eine Ordnungswidrigkeit ist eine rechtswidrige und vorwerfbare Handlung, die den Tatbestand eines Gesetzes verwirklicht, das die Ahndung mit einer Geldbuße vorsieht. Einige grundlegende Merkmale einer Ordnungswidrigkeit sind:
- Jede Ordnungswidrigkeit ist im Gesetz definiert und mit einer konkreten Buße belegt.
- Eine Ordnungswidrigkeit kann nur vorsätzlich oder fahrlässig begangen werden.
- Eine Ordnungswidrigkeit kann nur von natürlichen Personen oder juristischen Personen begangen werden.
- Eine Ordnungswidrigkeit kann nur verfolgt werden, wenn sie nicht verjährt ist.
Ein Bußgeldbescheid muss gemäß § 66 Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) folgende Angaben enthalten:
- Angaben zur Person des Betroffenen und etwaiger Nebenbeteiligter
- Name und Anschrift des Verteidigers, falls vorhanden
- Bezeichnung der Tat, die dem Betroffenen zur Last gelegt wird, Zeit und Ort ihrer Begehung, die gesetzlichen Merkmale der Ordnungswidrigkeit und die angewendeten Bußgeldvorschriften
- Die Beweismittel
- Die Geldbuße und die Nebenfolgen, z. B. die Anordnung eines Fahrverbots
- Die Rechtsmittelbelehrung, die über die Möglichkeit und Frist des Einspruchs informiert

2. Was sind die häufigsten Gründe für Bußgeldbescheide?
Die häufigsten Gründe für Bußgeldbescheide im deutschen Straßenverkehr sind Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung (StVO), die den Verkehrsteilnehmern verschiedene Regeln und Pflichten auferlegt. Die StVO enthält unter anderem Vorschriften über:
- Die zulässige Höchstgeschwindigkeit
- Den Sicherheitsabstand
- Das Überholen
- Das Abbiegen
- Das Halten und Parken
- Die Vorfahrt
- Die Benutzung von Lichtzeichenanlagen und Verkehrszeichen (z.B. Rot über die Ampel)
- Die Ladungssicherung
- Die Mitführung von Fahrzeugpapieren
Wer gegen diese Vorschriften verstößt, muss mit einem Bußgeld rechnen, das je nach Schwere des Verstoßes variieren kann. Der aktuelle Bußgeldkatalog gibt einen Überblick über die möglichen Sanktionen für verschiedene Verkehrsdelikte. Neben der StVO gibt es noch andere Gesetze, die Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr regeln, wie zum Beispiel:
- Das Straßenverkehrsgesetz (StVG), das unter anderem Vorschriften über die Zulassung von Fahrzeugen, die Fahrerlaubnis, den Versicherungsschutz und den Datenschutz enthält.
- Das Pflichtversicherungsgesetz (PflVG), das die Haftpflichtversicherung für Kraftfahrzeuge vorschreibt.
- Das Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG), das die Besteuerung von Kraftfahrzeugen regelt.
- Das Fahrpersonalgesetz (FPersG), das die Lenk- und Ruhezeiten sowie die Kontrollgeräte für Berufskraftfahrer festlegt.
3. Wie sollte ich reagieren, wenn ich einen Bußgeldbescheid erhalte?
- Wenn Sie einen Bußgeldbescheid erhalten haben, sollten Sie zunächst Ruhe bewahren und den Bescheid sorgfältig lesen.
- Prüfen Sie, ob alle Angaben korrekt sind und ob Sie den Tatvorwurf nachvollziehen können. Wenn Sie Zweifel an der Rechtmäßigkeit oder der Höhe des Bußgeldes haben, sollten Sie sich an einen Anwalt für Verkehrsrecht wenden, der Ihnen bei der Überprüfung des Bußgeldbescheids helfen kann.
- Wenn Sie den Bußgeldbescheid akzeptieren wollen, müssen Sie innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung die Geldbuße bezahlen oder eine Ratenzahlung vereinbaren. Wenn Sie den Bußgeldbescheid nicht akzeptieren wollen, müssen Sie innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung Einspruch einlegen. Der Einspruch muss schriftlich bei der Behörde eingehen, die den Bußgeldbescheid erlassen hat. In dem Einspruch müssen Sie Ihre Personalien angeben und den Bußgeldbescheid bezeichnen. Sie können auch die Gründe für Ihren Einspruch darlegen, müssen dies aber nicht.
- Wenn Sie Einspruch erheben, wird das Bußgeldverfahren fortgesetzt. Die Behörde kann Ihren Einspruch zurückweisen oder dem Einspruch abhelfen, indem sie den Bußgeldbescheid aufhebt oder ändert. Wenn die Behörde Ihren Einspruch zurückweist, wird das Verfahren an das zuständige Amtsgericht abgegeben, das über Ihren Einspruch entscheidet.
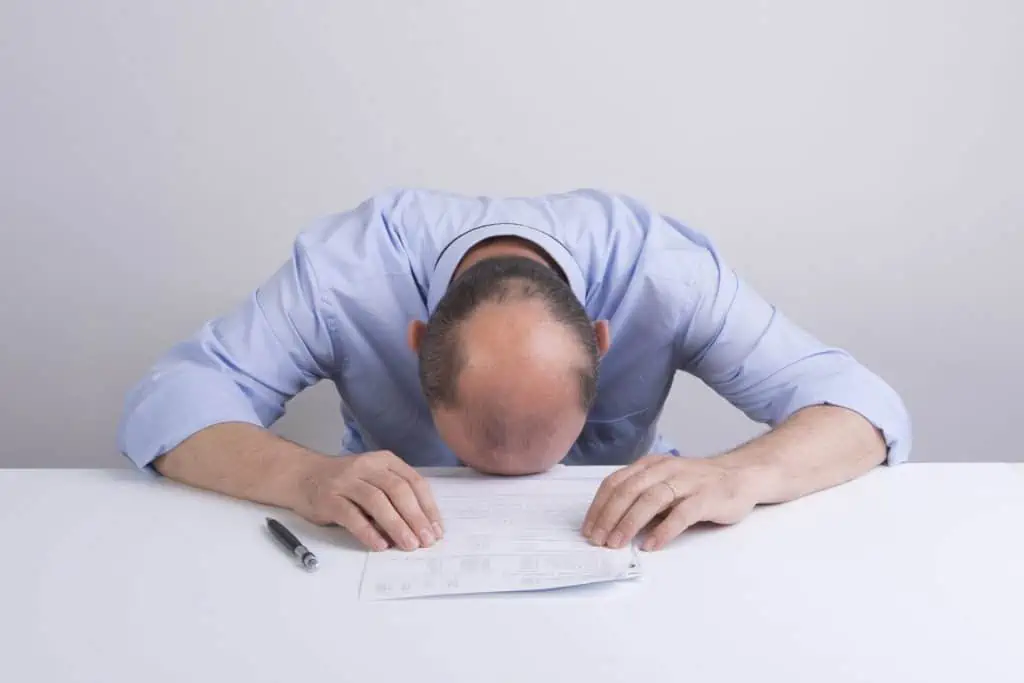
4. Ablauf des gerichtlichen Verfahrens
Das anschließende gerichtliche Verfahren beim Einspruch gegen den Bußgeldbescheid läuft in der Regel wie folgt ab:
- Sie erhalten eine Ladung zum Hauptverhandlungstermin, in der Ihnen der Termin, der Ort und der Gegenstand des Verfahrens mitgeteilt werden.
- Sie können sich vor dem Gericht selbst verteidigen oder sich von einem Anwalt vertreten lassen. Sie können auch Zeugen oder Sachverständige benennen, die Ihre Aussage stützen können.
- In der Hauptverhandlung werden die Beweise erhoben und die Beteiligten angehört. Sie haben das Recht, sich zu dem Tatvorwurf zu äußern oder zu schweigen.
- Nach der Beweisaufnahme wird das Urteil verkündet. Das Gericht kann den Bußgeldbescheid bestätigen, aufheben oder ändern. Das Urteil enthält auch die Kostenentscheidung, die festlegt, wer die Kosten des Verfahrens tragen muss.
- Gegen das Urteil können Sie innerhalb einer Woche nach Zustellung Rechtsmittel einlegen. Das Rechtsmittel kann eine Beschwerde oder eine Rechtsbeschwerde sein, je nachdem, ob es sich um eine Sach- oder eine Rechtsfrage handelt.
5. Wann sollte ich Einspruch gegen den Bußgeldbescheid einlegen?
Ein Einspruch macht dann Sinn, wenn Sie glauben, dass der Bußgeldbescheid fehlerhaft oder ungerechtfertigt ist. Mögliche Gründe für einen Einspruch sind:
- Formfehler: Der Bußgeldbescheid enthält nicht alle erforderlichen Angaben oder Belehrungen oder ist nicht ordnungsgemäß zugestellt worden.
- Sachverhaltsfehler: Der Bescheid beruht auf falschen oder unvollständigen Tatsachen oder Beweisen oder es liegen entlastende Umstände vor.
- Rechtsfehler: Es werden die falschen Gesetze oder Vorschriften angewendet oder Ihre Rechte oder Grundsätze des Verfahrensrechts werden verletzt.
- Verjährung: Der Bescheid ist erst nach Ablauf der Verjährungsfrist erlassen oder zugestellt worden.
Ein Einspruch gegen einen Bußgeldbescheid hat jedoch auch Risiken. Zum einen kann das Gericht eine höhere Geldbuße oder eine schärfere Nebenfolge verhängen, wenn es Ihren Einspruch für unbegründet hält. Zum anderen können durch das gerichtliche Verfahren zusätzliche Kosten entstehen, wie Gerichtsgebühren oder Anwaltskosten, die Sie tragen müssen, wenn Sie unterliegen. Daher sollten Sie sich vor einem Einspruch gut überlegen, ob Sie ausreichende Erfolgsaussichten haben und ob sich der Aufwand lohnt.
6. Wie ist die Verjährung beim Bußgeldbescheid geregelt?
Die Verjährung beim Bußgeldbescheid ist unter anderem in § 31 OWiG geregelt. Unterschieden wird zwischen der Verfolgungs- und der Vollstreckungsverjährung. Im Zusammenhang mit der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten besagt die Verjährung, dass diese eben nicht mehr verfolgt werden können, wenn eine bestimmte Frist abgelaufen ist. Die Verjährungsfrist beträgt grundsätzlich drei Monate ab dem Tag, an dem die Ordnungswidrigkeit begangen wurde. Die Frist kann jedoch durch verschiedene Umstände unterbrochen oder gehemmt werden, wie zum Beispiel:
- Die Anhörung des Betroffenen
- Die Erteilung eines Zeugnisverweigerungsrechts
- Die Anordnung einer erkennungsdienstlichen Behandlung
- Die Zustellung eines Bußgeldbescheids
- Die Einlegung eines Einspruchs
- Die Erhebung der öffentlichen Klage
- Die Ladung zur Hauptverhandlung
Die Verjährungsfrist endet spätestens nach zwei Jahren ab dem Tag, an dem die Ordnungswidrigkeit begangen wurde. Wenn jedoch ein Fahrverbot verhängt wurde, endet die Frist erst nach drei Jahren. Die Vollstreckungsverjährung, die in § 34 OWiG geregelt ist, läuft deutlich länger. Je nach Höhe des verhängten Bußgeldes sind es drei oder fünf Jahre.

7. Weitere wichtige Informationen rund um das Thema Ordnungswidrigkeiten
Neben den oben genannten Punkten gibt es noch weitere wichtige Informationen rund um das Thema Ordnungswidrigkeiten und Bußgeldbescheid, die Sie kennen sollten:
- Wenn Sie einen Bußgeldbescheid erhalten haben, sollten Sie auch auf mögliche Punkte in Flensburg achten. Das Fahreignungsregister (FAER) führt ein Punktesystem ein, das Verkehrssünder mit Punkten bestraft. Je nach Schwere der Ordnungswidrigkeit können Sie zwischen einem und drei Punkten erhalten. Wenn Sie acht Punkte erreicht haben, droht Ihnen der Entzug der Fahrerlaubnis.
- Achten Sie auch auf mögliche Auswirkungen auf Ihre Kfz-Versicherung. Je nach Versicherungsvertrag kann es sein, dass Sie einen höheren Beitrag zahlen müssen oder sogar gekündigt werden, wenn Sie einen Bußgeldbescheid erhalten haben. Informieren Sie sich daher bei Ihrer Versicherung über die möglichen Konsequenzen.
- Bei Erhalt eines Bescheids aus dem Ausland erhalten haben, sollten Sie diesen unter keinen Umständen einfach ignorieren. Denn durch verschiedene Abkommen und Verordnungen können Bußgeldbescheide aus anderen EU-Ländern auch in Deutschland vollstreckt werden. Die Höhe der Bußgelder kann dabei erheblich von den deutschen Bußgeldern abweichen. Wenn Sie einen Bußgeldbescheid aus dem Ausland erhalten haben, empfehlen wir Ihnen, sich an einen Anwalt für Verkehrsrecht zu wenden, der Ihnen bei der Prüfung und ggf. Abwehr des Bußgeldbescheids helfen kann.
Ein Anwalt für Verkehrsrecht kennt sich mit den aktuellen Gesetzen und Vorschriften aus und hat Erfahrung mit ähnlichen Fällen. Er kann Ihnen daher eine kompetente Beratung und Vertretung bieten und Ihre Erfolgschancen erhöhen. Gerne steht Ihnen Rechtsanwalt Alexander Einfinger zur individuellen Besprechung eines Bußgeldbescheids oder Anhörungsbogens zur Verfügung und unterstützt Sie mit Fachwissen, Einfühlungsvermögen und einem strukturierten Vorgehen.
Kennen Sie schon diese informativen Ratgeber rund um das Thema Verkehrsrecht? Lesen Sie doch mal rein!
- Worauf ist zu achten beim Oldtimer Kauf?
- Vorwurf der Fahrerflucht? Was Sie dazu wissen sollten - Hinweise vom Anwalt
- Anwalt Gewährleistungsrecht KFZ: 5 Fragen und Antworten
Fahrverbot umgehen
Wenn Sie einen Anwalt für Verkehrsrecht benötigen, erreichen Sie die Mobilrechtler per E-Mail: mail@mobilrechtler.de oder telefonisch unter 030 / 30348286.
Unser Sekretariat ist für Sie rund um die Uhr erreichbar und kümmert sich um Ihre Anliegen und Nachrichten.
Unfall im Ausland: Was tun? | Zentralruf der Autoversicherer
In der Welt der Hochleistungssportwagen gibt es Modelle, die die Herzen der Autofans im Sturm erobern und zu wahren Ikonen werden. Der BMW M3 E46 ist zweifellos eines dieser legendären Fahrzeuge, das sich einen festen Platz in der Geschichte der leistungsstarken Sportlimousinen verdient hat. Von 2000 bis 2006 in Produktion, hat der M3 E46 Maßstäbe in puncto Leistung, Handling und Stil gesetzt. Dieser Artikel widmet sich diesem faszinierenden Modell und hebt seine herausragenden Eigenschaften hervor.

Leistungsstarker Antrieb
Der wahre Star des BMW M3 E46 ist zweifellos sein beeindruckender Motor. Unter der Haube verbirgt sich ein 3,2-Liter-Reihensechszylinder-Saugmotor, der mit 252 kW (343 PS) und einem maximalen Drehmoment von 365 Nm beeindruckende Leistungsdaten liefert. Dieser Motor ist bekannt für sein spontanes Ansprechverhalten und sein beeindruckendes Drehvermögen, was dem Fahrer ein intensives Fahrerlebnis ermöglicht. Mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 5,1 Sekunden und einer elektronisch begrenzten Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h konnte der M3 E46 seine Konkurrenz in den Schatten stellen.
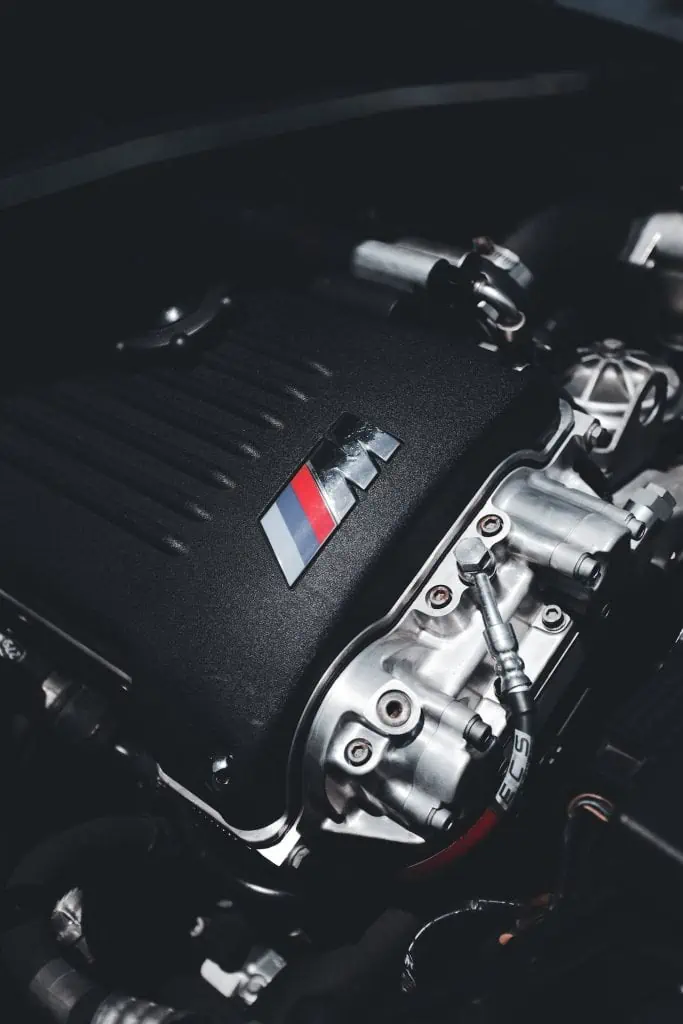
Präzises Handling
Der BMW M3 E46 bietet nicht nur rohe Leistung, sondern auch ein präzises und ausgewogenes Fahrverhalten. Das Fahrwerk wurde sorgfältig abgestimmt, um eine hervorragende Straßenlage und eine optimale Traktion zu gewährleisten. Die präzise Lenkung und das ausgewogene Handling machen den M3 E46 zu einem wahren Fahrerlebnis. Dieses Auto kann sich auf kurvenreichen Straßen genauso gut behaupten wie auf der Rennstrecke.
Elegantes Design
Das Design des BMW M3 E46 besticht durch seine zeitlose Eleganz und Sportlichkeit. Die ausgestellten Kotflügel, die breite Spur und das charakteristische "M" auf den Außenspiegeln verleihen dem M3 E46 einen unverwechselbaren, sportlichen Auftritt. Das Interieur ist ebenfalls von hoher Qualität und bietet Sportsitze, ein M-Lenkrad und spezielle M-Details, die den sportlichen Charakter unterstreichen. Das klare und funktionale Design des Cockpits ermöglicht es dem Fahrer, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Das SMG-Getriebe
Eine der bemerkenswerten Innovationen des M3 E46 war das optional erhältliche SMG-Getriebe (Sequential Manual Gearbox). Dieses automatisierte Schaltgetriebe ermöglichte es dem Fahrer, manuell zu schalten, ohne ein Kupplungspedal zu betätigen. Es bot auch verschiedene Fahrmodi, um den Bedürfnissen des Fahrers gerecht zu werden. Die SMG-Technologie war ein wichtiger Schritt hin zu den modernen Doppelkupplungsgetrieben, die heute in vielen Hochleistungsfahrzeugen zu finden sind.
Sammlerwert und Erbe
Der BMW M3 E46 hat nicht nur einen besonderen Platz in den Herzen der Autofans, sondern erfreut sich auch als begehrtes Sammlerfahrzeug großer Beliebtheit. Seine begrenzte Produktion und seine beeindruckenden Leistungsdaten machen ihn zu einem begehrten Modell auf dem Gebrauchtmarkt. Viele Liebhaber schätzen den E46 als einen der letzten M3-Modelle mit einem reinen Saugmotor, bevor Turbolader und Elektrifizierung Einzug hielten.
Der BMW M3 E46 ist zweifellos ein Meilenstein in der Geschichte der Hochleistungssportwagen. Seine Kombination aus Leistung, Handling und stilvollem Design hat ihn zu einer Ikone gemacht, die auch nach vielen Jahren noch bewundert wird. Dieses Fahrzeug verkörpert die Leidenschaft und das Streben nach Perfektion von BMW im Bereich der Hochleistungsfahrzeuge und bleibt ein zeitloses Symbol für Fahrspaß und Innovation.
Fragen zum Autokaufrecht? Geblitzt worden? Bußgeldbescheid erhalten?
Wenn Sie einen Anwalt für Verkehrsrecht benötigen, erreichen Sie die Mobilrechtler per E-Mail: mail@mobilrechtler.de oder telefonisch unter 030 / 30348286.
Unser Sekretariat ist für Sie rund um die Uhr erreichbar und kümmert sich um Ihre Anliegen und Nachrichten.
Unfall im Ausland: Was tun? | Zentralruf der Autoversicherer
Bei einem Oldtimerkauf sind viele Dinge abseits rein rechtlicher Erwägungen zu berücksichtigen, die vielleicht im ersten Moment nicht gleich offensichtlich sind. Wir haben Ihnen in diesem Beitrag eine Liste zusammengetragen mit den wichtigsten Dingen, die beim Oldtimerkauf zu beachten sind.
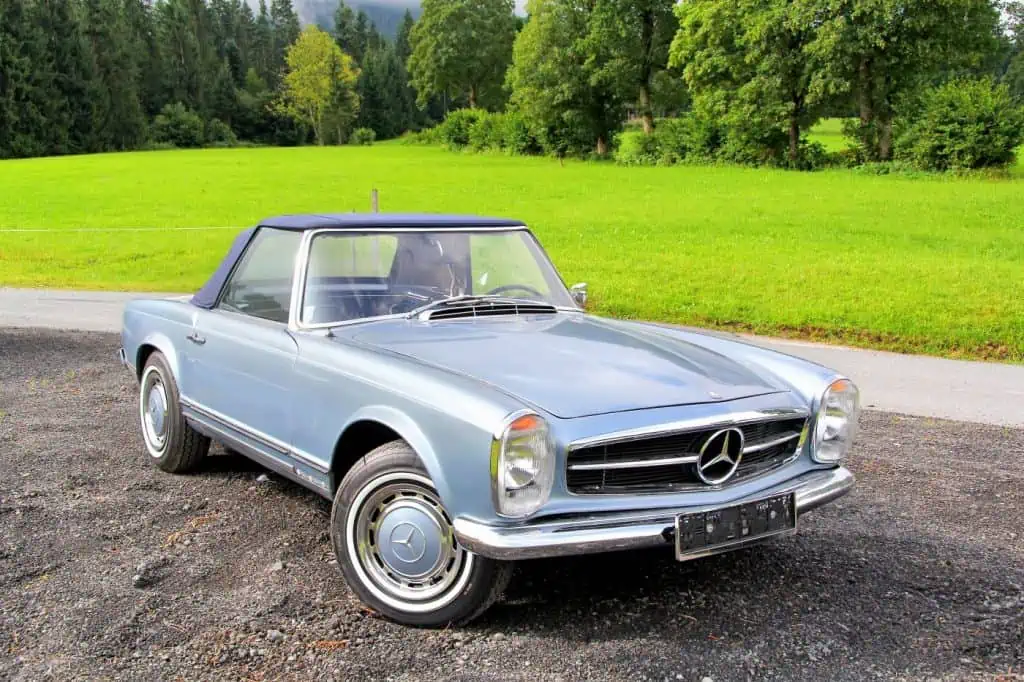
Bei jedem Autokauf zu prüfen
Immer, wenn Sie einen gebrauchten Wagen kaufen wollen, gibt es eine Reihe von Dingen, denen Sie grundsätzlich Aufmerksamkeit schenken sollten.
- Unfallwagen: So ist es zunächst gut zu wissen, ob der Wagen, den Sie kaufen wollen, in Unfälle verwickelt war. Selbst, wenn offensichtliche Schäden repariert wurden, kann es bei Unfallwagen zu Mängeln kommen, die auf den ersten Blick übersehen wurden.
- Vorbesitzer: Der nächste Punkt, den Sie prüfen sollten, ist die Anzahl der Vorbesitzer und ob diese Vorbesitzer gewissenhaft Scheckheftpflege betrieben haben. Bei einem scheckheftgepflegtem Wagen sind alle vom Hersteller vorgeschriebenen Inspektionen in den empfohlenen Abständen von Werkstätten durchgeführt worden, die nach Herstellerangaben arbeiten. Alle Wartungen sind im Serviceheft, eben dem umgangssprachlich als Scheckheft bekannten Heft, dokumentiert.
- Papiere: Prüfen Sie die Vollständigkeit und Echtheit der Papiere des Wagens, den Sie kaufen wollen.
Besonderheiten bei Oldtimern
Der Wert eines Oldtimers wird durch seinen Oldtimerstatus bestimmt. Daher ist es wichtig, dass Sie auch diesen Status einer genauen Prüfung unterziehen.
Gutachten und Sachverständigen-Prüfung
- Wertgutachten: Bei einem Oldtimerkauf sollte immer ein Wertgutachten vorliegen. Liegt dieses noch nicht vor oder ist von einem unbekannten Gutachter erstellt worden, sollten Sie zur Sicherheit ein eigenes erstellen lassen. Um den Status des Oldtimers zu erhalten, muss der Wagen auf jeden Fall einem Gutachten nach § 23 StVZO unterzogen werden. Dieses Gutachten bestätigt, dass das Fahrzeug Teil der „Pflege des kraftfahrzeugtechnischen Kulturgutes“ ist, was unter anderem die Voraussetzung für ein H-Kennzeichen ist.
- Persönliche Prüfung: Über dieses Gutachten hinaus sollten Sie den Wagen mit einem fachkundigen Sachverständigen gemeinsam genau unter die Lupe nehmen.
- Händler mit einbeziehen: Bei vielen vertrauenswürdigen Händlern können Sie die Möglichkeit wahrnehmen, den Wagen in der Werkstatt vor dem Kauf auf Herz und Nieren durchchecken zu lassen.

Modellrecherche
Alle bisher genannten Hinweise gelten grundsätzlich für alle Oldtimer, die Sie für einen Kauf in Betracht ziehen. Doch auch modellspezifisch gibt es einige Dinge zu beachten. Da hier auf jedes einzelne Oldtimer-Modell einzugehen den Rahmen sprengen würde, wollen wir Ihnen stattdessen eine Anleitung an die Hand geben, mit der Sie Schwachstellen des Modells Ihrer Wahl ausfindig machen können.
- Modellspezifische Eigenarten: Ein Sachverständiger, der auf Oldtimer-Käufe spezialisiert ist, kann Ihnen in jedem Fall schon weiterhelfen. Doch darüber hinaus sollten Sie sich im Vorfeld über das Modell informieren. Das können Sie zum Beispiel in Internetforen tun, die es beinahe für jedes Modell gibt. Auch Liebhaber-Clubs in Ihrer Nähe stehen Ihnen gerne zur Seite, wenn es darum geht, typische Schwachstellen zu identifizieren, damit Sie bei der Besichtigung oder Probefahrt genau darauf achten können.
Neben technischen Schwachstellen, die sehr individuell ausfallen können, gibt es aber modellübergreifend auch einige Dinge, auf die Sie achten sollten.
- Rost: Alte Autos, wie es Oldtimer ja nun einmal sind, haben oft mit Rost zu kämpfen. Die Stellen unterscheiden sich hier stark, doch gerade, wenn Ihr Traumwagen aus den Vereinigten Staaten von Amerika kommt, gilt es, den Zustand der Lackierung penibel genau zu überprüfen. Stammt der Lack noch vom Werk? Oder wurden eventuelle Neulackierungen durchgeführt? In diesem Fall sollten Sie die Qualität der Lackierung prüfen lassen. In den USA gelten hier nämlich andere Regelungen und Standards, die dem unwissenden Käufer zum Verhängnis werden können.

Kaufen Sie Ihren Oldtimer von einem vertrauenswürdigen Verkäufer
Dieser Punkt sollte fast selbstverständlich sein, doch der Vollständigkeit halber werden wir ihn nicht übergehen. Natürlich kann es sein, dass sie auf den bekannten Online-Marktplätzen ein Schnäppchen machen können und einen richtigen Glücksgriff landen.
- Gewerbliche Verkäufer bevorzugen: Auf der sicheren Seite befinden Sie sich jedoch eher bei gewerblichen Oldtimer-Händlern und auf Oldtimer ausgerichtete Portale. Auf den Oldtimer-Portalen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Fahrzeugbescheinigungen, Gutachten und Bilder einzusehen. Außerdem ordnen solche Portale die Wagen oft nach der Benotungstabelle der Classic Data ein, so dass Sie schon online eine erste Einschätzung des Zustandes erhalten.
- Classic Data: Die Classic Data vergibt Benotungen von 1 bis 5, wobei 1 die Bestnote „makellos“ ist, und 5 einen „mangelhaften“ Zustand beschreibt, bei dem der Wagen in der Regel nicht fahrbereit ist.
Um Händler in Ihrer Nähe zu finden, können Sie wieder die Hilfe lokaler Oldtimer-Vereine in Anspruch nehmen.
Unser Tipp: SJS Carstyling-Blog zum Gewährleistungsrecht
Seit dem 01. Januar 2022 gelten neue Regelungen im Kaufrecht im BGB. Diese neuen Regelungen betreffen auch den gewerblichen Verkauf von Händlern an private Kunden von Oldtimern - und werden im Alltag leider größtenteils missachtet. Die Anpassungen können Sie im Blog von SJS Carstyling nachlesen. Hierzu haben die Spezialisten der EINFINGER Anwaltskanzlei – die Mobilrechtler – für Sie die wichtigsten Regelungen, welche den Oldtimerkauf betreffen, zusammengefasst.